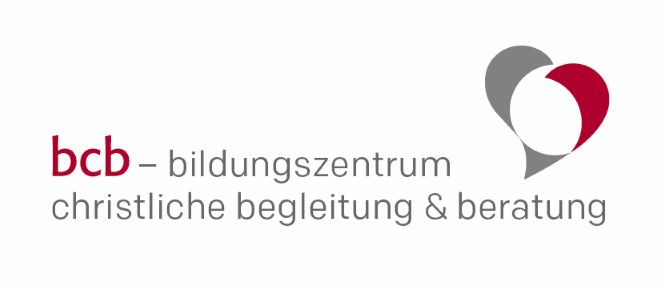Beichte – Neuanfang mit Unterstützung
Die Beichte hat vielfach einen schlechten Ruf – und sie hat ihn nicht verdient. Ihr Klischee, in Filmen und Büchern verbreitet, sagt, dass dabei ein Priester über alle gesunden Grenzen hinweg Details aus dem Leben anderer wissen will. Anschliessend verordnet er als Strafe zehn Ave-Maria und zehn Vaterunser. Es sagt, dass sich Messdiener auf dem Weg in den Beichtstuhl austauschen: «Okay, heute sagst du etwas von unreinen Gedanken und ich erzähle, dass ich gelogen hätte. Irgendetwas müssen wir ja beichten …» Natürlich kommen solche Auswüchse vor, doch es wäre fatal, wenn wir zuliessen, dass sie das überdecken, was Beichte wirklich ist und kann. Es gibt sie längst nicht nur in der katholischen Kirche und sie ist auch nicht auf Beichtstühle angewiesen. Sie ist eine geistliche Praxis, die bis heute ihre Berechtigung hat und extrem hilfreich ist, ein Neuanfang mit Unterstützung. Nicht umsonst empfahl Martin Luther mit Blick auf die Beichte: «Bist du arm und elend, so gehe hin und gebrauche die heilsame Arznei.»
Form und Möglichkeiten
Dass wir die Beichte schnell mit der katholischen Kirche in Verbindung bringen, liegt daran, dass sie hier als Sakrament gilt, also als «sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit der Liebe Gottes». Doch auch in den evangelischen Kirchen und Freikirchen ist die Beichte bekannt. Hier gilt sie nicht als verpflichtend, bleibt aber ein wichtiges Mittel zur Versöhnung und zum Wiederherstellen der Beziehung zwischen Gott und Menschen, wenn wir etwas getan haben, was sich dazwischen gestellt hat. Dieses Schuldeingeständnis gegenüber Gott kann direkt ihm gegenüber geschehen, wie es Johannes in seinem Brief andeutet: «Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.» Es kann auch allgemein von mehreren im Gottesdienst gemeinsam angesprochen werden wie zum Beispiel im Vaterunser: «Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern.» In erster Linie ist mit der Beichte aber auch im evangelischen Umfeld gemeint, dass wir zu einer Person unseres Vertrauens gehen, ihr erzählen, was uns an Schuld belastet und uns Gottes heilsame Vergebung zusprechen lassen, wie es Jakobus in seinem Brief ausgedrückt hat: «Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet!» Warum kann die Beichte so heilsam sein?
Geheim oder nicht?
Ein Teil der Wirksamkeit der Beichte liegt im psychologischen Bereich. Sie leistet etwas ungeheuer Wertvolles: Sie holt Scham und Schuld aus dem Verborgenen heraus und stellt sie ein Stück weit ins Licht. Damit ist die Beichte das Ende des Doppellebens und Versteckspielens. Sie bricht krankmachende Geheimhaltung. «Wenn unsere Geheimnisse aus der Bahn laufen und anfangen, uns zu kontrollieren, dann wird aus dem normalen Leben irgendwann ein geheimes zweites Leben», stellt die Psychiaterin Gail Saltz fest und beschreibt damit deren negative Dynamik. Geheimnisse in einem vertraulichen Rahmen auf den Tisch legen zu können, nimmt ihnen diese Macht. König David beschreibt die Negativauswirkungen von verheimlichter Schuld so: «Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag.»
Darüber hinaus sind noch zwei Punkte wichtig: Die negativen Auswirkungen eines Geheimnisses können gebrochen werden, indem wir mit einzelnen Personen, guten Freundinnen, Seelsorgern, Pfarrerinnen und anderen Vertrauenspersonen sprechen – es geht jedoch nicht darum, alles in die Öffentlichkeit zu zerren. Nicht umsonst ist das Seelsorge- oder Beichtgeheimnis ein hohes Gut. Ausserdem hält die Beichte uns in erster Linie selbst den Spiegel vors Gesicht. Wenn wir als Christen vor Gott zu unseren (heimlichen) Sünden stehen, dann sagt Gott weder «Das überrascht mich jetzt» noch «Damit hast du mich aber enttäuscht». Gott weiss es bereits. Es geht darum, dass wir ehrlich zu uns selbst werden. Was sind die Auswirkungen davon?
Vergebung und Freiheit
Die Folge unserer Beichte ist in der Regel keine Wiedergutmachung, kein Handeln, um Dinge wieder geradezurücken. Manchmal kann das hinzukommen, doch das hauptsächliche Anliegen der Beichte ist es zu verstehen, dass Gottes Vergebung die ganze Zeit da war. Sie ist der Zuspruch, den Jesus selbst immer wieder Menschen gegeben hat, die ihm begegneten: «Deine Sünden sind dir vergeben!» Und dieser Zuspruch hat wesentlich mehr Kraft, wenn er von aussen kommt. Deshalb tut es gut, sich anderen gegenüber zu öffnen, eigenes Versagen zuzugeben und sich dann sagen zu lassen: «Gott ist und bleibt dir gnädig. Du bist und bleibst sein Kind. Er hat dir vergeben. Fang wieder neu mit ihm an.» Wichtig zum Verständnis der Beichte ist: Nicht Gott braucht sie, um vergeben zu können – das hat er längst getan. Wir brauchen sie, um uns klarzumachen: Der Reset-Knopf ist längst gedrückt. Was uns belastet hat, ist weg. Ein Neustart ist möglich – und zwar immer wieder.
Zum Thema:
In der Gondel: Zwischen Himmel und Erde das Gewissen erleichtern
Mehr als «Entschuldigung!»: Vergebung – das missverstandene Gebot
Der Weg der Versöhnung: Immer wieder vergeben?!
Datum: 25.08.2025
Autor:
Hauke Burgarth
Quelle:
Livenet