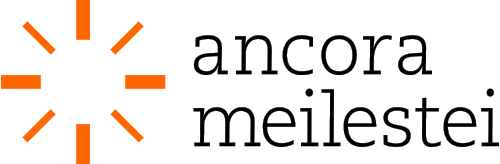Die Reproduktionsmedizin mit ihren Möglichkeiten der Befruchtung ausserhalb des weiblichen Körpers hat das embryonale Leben im Labor verfügbar gemacht. Der als natürlich empfundene doppelte Status des Embryos als werdendes Leben innerhalb und als nicht-werdendes Leben ausserhalb des Mutterleibes fällt mit dieser Neuheit dahin. Damit drängt sich verstärkt die Frage nach einer Zäsur auf: Wann beginnt menschliches Leben als personales Leben mit Würde und Rechtsschutz zu existieren? Der Philosoph Norbert Hörster macht den Vorschlag, Menschenrechte durch Personenrechte zu ersetzen – ein Vorhaben, dem der Philosoph Robert Spämann vehement widerspricht: „Es sind bestimmte Eigenschaften von Menschen, die uns dazu veranlassen, Menschen Personen zu nennen. Aber was wir Personen nennen, sind nicht diese Eigenschaften, sondern deren Träger.“ Für Spämann sind Menschsein und Personsein identisch. Die biologische Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung sei das einzig zulässige Kriterium für die Zuschreibung von Menschenwürde und Menschenrechten. Auch aus biblischer Sicht hängt das Personsein nicht von wahrnehmbaren körperlichen und seelisch-geistigen Fähigkeiten ab. Vielmehr beruht es auf der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Diese ist keine empirische, sondern eine göttliche Qualität. Das Menschsein liegt nicht in dem, was der Mensch hat oder kann, sondern in dem, was er in Beziehung zu Gott ist. Der Mensch ist aber von Gott her grundlegend dazu bestimmt und berufen, Gegenüber zu sein und in Gemeinschaft und Liebe mit Gott zu leben. Als ein von Gott angesprochenes Geschöpf besitzt er die Verantwortung, mit sich, mit seinen Mitgeschöpfen und mit seiner Umwelt fürsorglich umzugehen (Gen 1,27f.). Dies macht den Menschen zur Person. Personen aber haben keinen Wert, sondern Würde. Und Würde lässt sich nicht zu anderen Zwecken verwerten. Menschenwürde ist eine von Gott zugesprochene Würde (dignitas aliena), mit der Gott den Menschen bekleidet. Sie wird von keiner menschlichen Fähigkeit oder Leistung mitbedingt. Sie kommt auch dem Sünder zu, denn sie ist eine verheissene Würde: Der Mensch hat schon jetzt in seinem irdischen Leben teil an der vollendeten Würde in Jesus Christus, der das wahre Ebenbild Gottes ist (Kol 1,15; 3,10; 1 Joh 3,2). Dies betrifft das schwerstbehindert geborene, später erkrankte oder verunfallte Leben ebenso wie das noch ungeborene Leben. Gerade darin besteht die christliche Hoffnung auf Vollendung des Lebens über den Tod hinaus. Aus dieser umfassenden theologischen Perspektive betrachtet, fallen menschlicher Lebensbeginn, Personsein und Personwürde zusammen. Wann aber beginnt das menschliche Leben? Diese Frage kann die Theologie nicht alleine beantworten. Aus biologischer Sicht spricht viel dafür, den Beginn menschlich-organischen Lebens mit der Zeugung anzusetzen. Nicht das tote Erbgut, wohl aber die mit der Zeugung vorhandene Leiblichkeit ist die Grundlage des Mensch- und Personseins. Der aus dem Ackerboden (adamáh) geformte Mensch (adám) bekam mit dem Lebensodem nicht eine Geistseele, die sich vom Leib unterscheidet, sondern er wurde als Ganzes mit seiner Leiblichkeit ein „lebendiges Wesen“ (1 Mose 2,7). Leiblichkeit ist darum kein biologisches „Etwas“, sondern Grundlage des Personseins. Leben und Würde sind also gleich zu stellen, und der Embryo entwickelt sich kontinuierlich als Mensch und nicht zum Menschen, selbst wenn die Zygote (befruchtete Eizelle) später absterben oder sich zu Mehrlingen teilen sollte. Die Ehrfurcht vor dem Leben gebietet daher auch dem Skeptiker, der befruchteten Eizelle Personsein und Würde zuzusprechen. In jüngster Zeit wird theologisch der Versuch unternommen, im Hinblick auf das Schicksal überzähliger Embryonen zwischen bloss menschlichem Leben und dem Leben eines werdenden Menschen, dem allein Menschenwürde zukomme, zu unterscheiden. So durch den Zürcher Ethiker Johannes Fischer. Ein überzähliger Embryo sei noch kein werdender Mensch, weil das Ende seiner Entwicklung nicht erwartbar sei. Erwartbar werde es, „wenn die Gemeinschaft existierender Personen sich auf ihn als Person bezieht“ und damit die äusseren Entwicklungsmöglichkeiten hin zum existierenden Menschen gegeben seien. Wenn allerdings der Mensch das von und zu Gott in Beziehung gesetzte Wesen ist, dann ist die Beziehung Gottes nicht identisch mit der Beziehung von existierenden Personen: „Gottes Leben schaffendes Verhältnis zum Embryo ist . früher (existent) als das physiologische Verhältnis der Mutter zum Embryo, das mit der Nidation gesetzt wird. Deshalb muss auch ein durch IVF gezeugter Embryo als Geschöpf Gottes – geschaffen mittels Menschen durch medizinische Möglichkeiten – gedacht werden, das unter dem uneingeschränkten Schutz der Personwürde steht“ (Ulrich Eibach). Der durch Gottes Wort ins Leben gerufene Embryo bleibt auch dann ein „Jemand“, wenn ihm die Antwort in und durch die Gemeinschaft existierender Personen versagt bleiben muss und er als überzähliger Embryo zu keiner Persönlichkeit mit Charakter und einer eigenen Lebensgeschichte heranwachsen kann. Der Embryo gehört nicht in die Glasschale, sondern in den Körper einer Frau. Die Tatsache, dass es überzählige Embryonen gibt, heisst nicht, dass man mit ihnen experimentieren und sie für die Stammzellforschung instrumentalisieren darf. Wenn eine Frau ihren Körper nicht zur Lebenserhaltung zur Verfügung stellen will, kann man daraus keinen freien Zugang zum Embryo schliessen (Ruth Baumann-Hölzle). „Sterben lassen und Töten sind nicht nur am Lebensende (passive und aktive Euthanasie), sondern auch am Lebensanfang grundsätzlich zu unterscheiden“ (Eibach). Die Verfügbarkeit über embryonales Leben im Labor ist ein Schritt weg vom Schicksal hin zur Planbarkeit und Ausgestaltung des Lebens nach eigenen Wünschen. Reproduktionsmedizin und Gentechnologie verkleinern den Schritt von der Heilung hin zur Züchtung und Verbesserung von Leben. Der Zwang zur Gesundheit beginnt bereits das Recht des schwachen und kranken Lebens bedrohlich zu bedrängen. Nun sind Krankheit und Leiden auch aus christlicher Sicht nicht einfach hinzunehmen. Vielmehr sind Natur und Schöpfung zu unterscheiden, wenn auch nicht zu trennen. Christen und Christinnen können Krankheit und Leiden nur als zerstörerischen Einbruch in die Schöpfung Gottes deuten, ein immer unbegreifbar bleibender und oft unzumutbar empfundener Einbruch, der sich nicht selten als unabweisbar herausstellt. Wo er aber abweisbar ist, da sollen und dürfen wir ihn bekämpfen, da steht das Heilen im Dienst des menschlichen und nichtmenschlichen Lebens und seiner Umwelt. Krankheit und Leiden sind nie in und aus sich sinnvoll. Sie vermögen die Würde des Menschen aber genauso wenig zu bedrohen, wie die Gesundheit sie zu verleihen vermag: „Das christliche Verständnis des Menschen ist am leidenden und getöteten Jesus von Nazareth orientiert und behauptet gerade im Blick auf den durch die Kreuzigung entsetzlich entstellten Christus, dass sich in ihm die Würde des Menschen manifestiert“ (Ernst Jüngel). Im Leiden und Sterben Christi erfährt der Mensch die Zusage, dass sein Leben trotz und innerhalb seinen Grenzen sinn- und wertvoll bleibt. Es befreit ihn von fiktiven und vermessenen Erwartungshaltungen an die Medizin und lässt ihn auf Vollendung seines Lebens jenseits seiner eigenen Begrenztheit hoffen. Es befreit ihn zum Dienst am und zur Ehrfurcht vor allem Leben. Wer so das wahre Leben von Gott erwartet, wird vom Zwang befreit, ein glückliches Leben allein von der technischen Beherrschung des Lebens zu erwarten. Was eine solche Ethik des Verzichts in der Frage der verbrauchenden Embryonen- und Stammzellforschung bedeutet, liegt auf der Hand ... Webseite: www.ebausteine.ch Autor: Martin Kraut/ Antoinette LüchingerMachen Kriterien die „Person“ aus?
Der umstrittene australische Ethiker Peter Singer behauptet, menschliches Leben und Personsein seien nicht identisch. Der Wert menschlichen Lebens sei in verschiedenen Phasen unterschiedlich, und weil der Embryo noch keine Person sei, habe kein Embryo denselben Anspruch auf Leben wie eine geborene Person. Der Mensch sei Person, wenn er bestimmte Kriterien wie Vernunft, Interessen, Selbstbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit oder Handlungsfreiheit erfülle. Diese seien aber erst im Verlaufe seiner Entwicklung oder mit der Geburt gegeben.
Zugesprochene Würde
Wann beginnt das menschliche Leben?
Ehrfurcht vor dem Leben
Wie entsteht „Person“?
Diese Argumentation trägt dem dialogischen Charakter des Menschseins Rechnung. Der Mensch existiert erst von anderen her und auf andere hin. Wo er nicht erwartend in die Gemeinschaft aufgenommen wird, da kann er nicht zu einer Persönlichkeit werden. Die befruchtete Eizelle hat in vitro (im Reagenzglas) weder Überlebenschance noch Beziehung: Sie braucht die Einnistung in die Plazenta und die Verbindung mit dem Mutterleib, woher sie lebensnotwendige Nähr- und Abwehrstoffe empfängt. Es ist gut denkbar, dass auch psychische, vielleicht sogar charakterbildende, Einflüsse in dieser vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung wirksam werden.
Leben nach Wunsch planen?
Würde auch im Leiden
Datum: 22.09.2003
Quelle: Bausteine/VBG