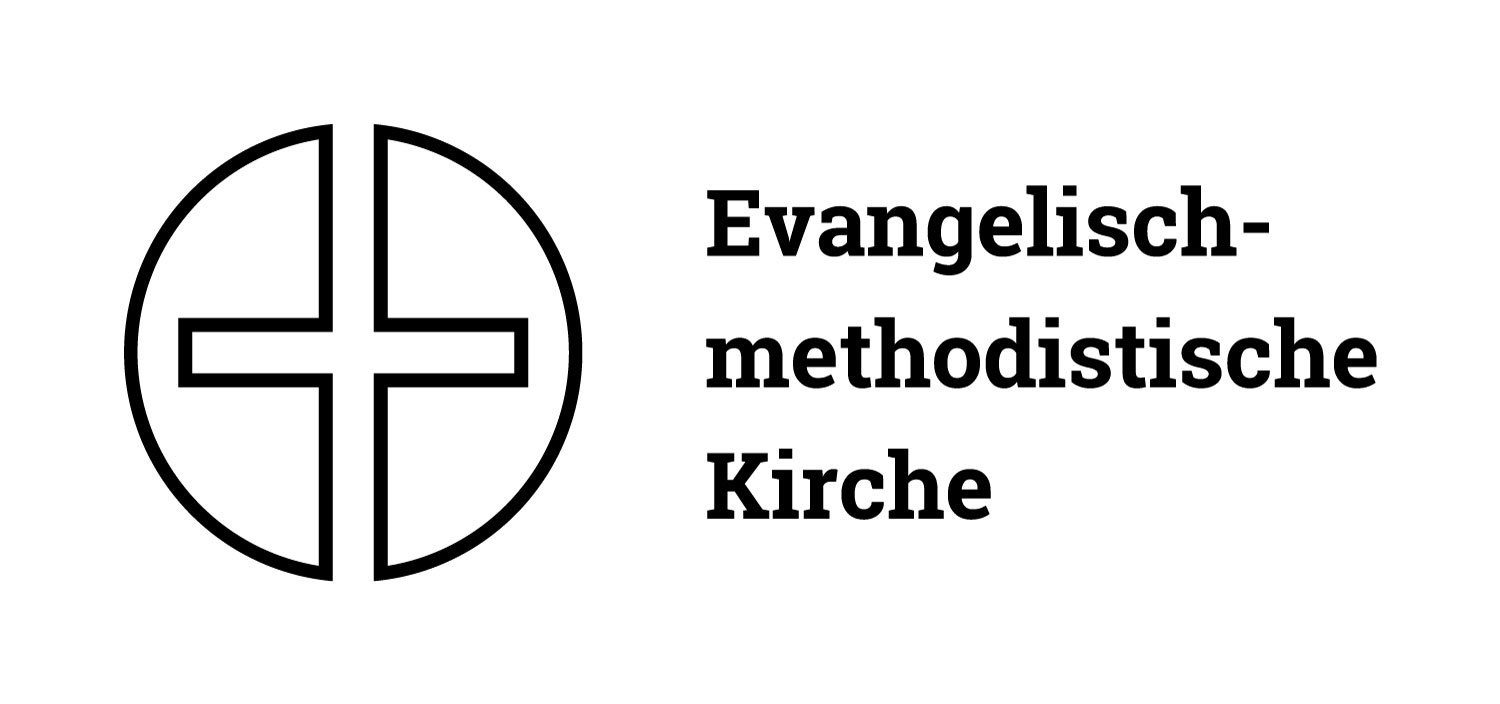Auf den ersten Blick scheint der 32-jährige Agraringenieur mit Staatspräsident Luis Inacio Lula da Silva übereinzustimmen. Doch der Teufel steckt im Detail. Das rund 180 Millionen Einwohner zählende Brasilien ist nach Uno-Angaben Weltmeister bei Sozialkontrasten - und ein Land erstaunlichster Paradoxe. Lula zeigt sich überzeugt, dass Brasilien bis 2015 so gut wie alle von der Uno gesteckten Millenniumsziele erreicht: "Extreme Armut und Hunger um die Hälfte zu reduzieren, allen Kindern den Schulbesuch zu garantieren - das haben wir doch schon fast geschafft." Und auch die brasilianische Uno-Expertin Maria Oliveira betont, dass im Stichjahr 1990 noch 8,8 Prozent der Brasilianer täglich mit weniger als einem Dollar auskommen mussten - also gemäss den Kriterien der Weltbank in extremer Armut lebten. Heute seien es nur noch etwa halb so viele. Doch Oliveira weiss: "Extreme Armut in Brasilien exakt zu definieren, ist sehr schwierig." Selbst die Regierung gehe von 20 Millionen Brasilianern in tiefem Elend aus. Caritas-Koordinator Vieira trifft in Minas Gerais trotz der Sozialprogramme täglich auf viele Hungernde. Die Slumgürtel der Städte schrumpfen nicht, sie wachsen rasch weiter. "Die Hilfen der Regierung sind nur Almosen. Sie lindern das Elend etwas, aber beseitigen sie nicht." Von einer Lösung des Problems, so Vieira, "sind wir noch weit entfernt!" Er bestätigt Regierungsangaben, wonach derzeit 7,5 Millionen Familien eine monatliche Hilfe von umgerechnet mindestens knapp 8 und maximal knapp 48 Schweizer Franken erhalten, um sich das Nötigste kaufen zu können. 30 Millionen Begünstigte von mehr als 50 Millionen Berechtigten - das sei zu wenig. Almosen reichten nicht aus; man müsse diese bislang abhängigen Menschen in den Arbeitsmarkt und damit in die Gesellschaft integrieren. Den Betroffenen sind die Gaben der Regierung jedenfalls sehr willkommen. Leticia Alves, Mutter von vier Kindern im nordöstlichen Guaribas, kann mit ihrer neuen Magnetkarte monatlich umgerechnet 26 Franken abheben: "Ohne die Karte wären wir schon verhungert!" Und Paulo Machado, Strassenverkäufer aus derselben Region, freut sich über die Zahlungen wegen seiner 16 Kinder: "Ohne das Geld müsste ich mich als Händler schier zerfetzen." Doch reicht es zur Flucht aus dem Elend? "Mit durchschnittlich 35,5 Franken pro Familie sind bei dem brasilianischen Preisniveau nicht mal die Minimalbedingungen erfüllt, um extreme Armut überwinden zu können", analysiert Eneas da Rosa, der die brasilianische Filiale der internationalen Hunger-Hilfsorganisation FIAN leitet und mit dem katholischen Hilfswerk Misereor kooperiert. Die staatlichen Sozialprogramme, so da Rosa, lösten nicht das Hungerproblem. Jede bedürftige Familie brauche mindestens 154 Franken monatlich vom Staat, also den ohnehin sehr knapp bemessenen Minimallohn Brasiliens, um sich einigermassen ernähren zu können. Und: "Bei entsprechendem politischem Willen wären die Mittel auch verfügbar." Schliesslich ist das Drittweltland Brasilien die 14. Wirtschaftsnation, dazu der weltgrösste Rindfleischexporteur der Welt. Die meisten europäischen Staaten, darunter etwa Russland, hat es ökonomisch längst hinter sich gelassen. 2004 stieg die Zahl der Dollar-Millionäre Brasiliens um mehr als sieben Prozent. Doch riesige Elendszonen bleiben bestehen. Experten befürchten daher, dass Brasilien zwar die Millenniumsziele erreicht - ohne jedoch im Sozialsektor die erwarteten qualitativen Fortschritte zu machen. Die bisherigen Hilfsprogramme, so kritisieren auch Uno-Organisationen, nützen den am meisten leidenden Brasilianern am allerwenigsten. Denn diese müsse man gewöhnlich erst mal ausfindig machen, amtlich registrieren, ihnen helfen, Gelder zu beantragen - und danach kontrollieren, ob sie die Hilfe auch tatsächlich erhalten. Über elf Prozent der Erwachsenen sind Analphabeten. Zwar gehen inzwischen die meisten Kinder armer Familien in öffentliche Schulen, doch die Qualität des Unterrichts ist extrem schlecht. Carlos Lopes, Chef der Uno-Mission in Brasilia: "Selbst wenn Brasilien insgesamt vorankommt, wird der Abstand zwischen den Ärmsten und den Reichsten nicht geringer." Autor: Klaus HartExakte Definierung von Armut schwierig
"Ohne die Karte schon längst verhungert"
Ziele ohne qualitative Fortschritte im Sozialen
Abstand zwischen Ärmsten und Reichsten nicht geringer
Datum: 19.09.2005
Quelle: Kipa