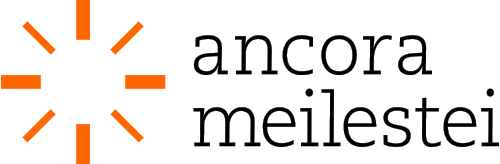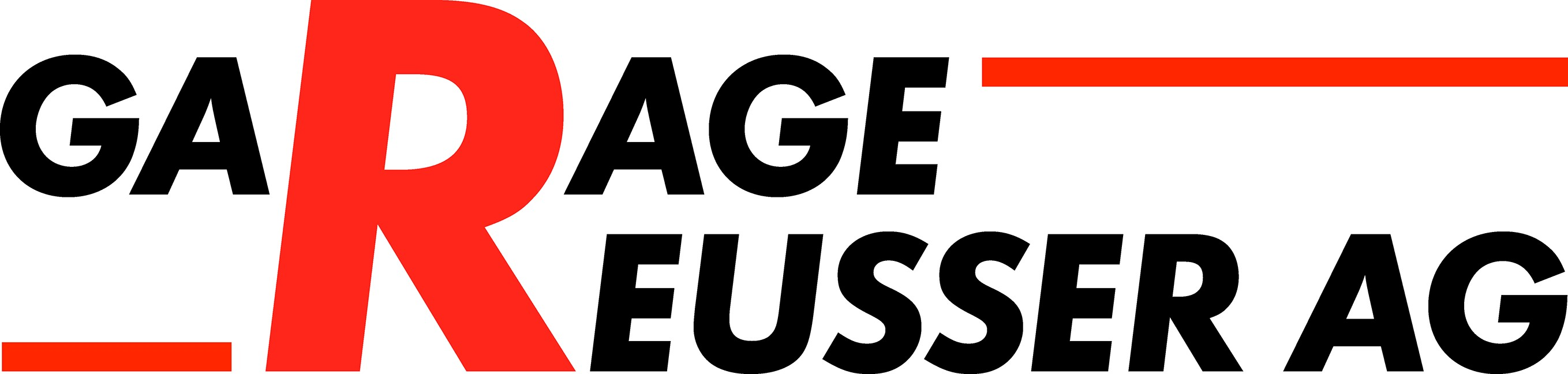Auf welcher Welle funkt die Ethik?
Einmal im Januar veranstaltet das Tagungshaus Rügel in Seengen ein Podiumsgespräch zu einem aktuellen Thema. Der diesjährige Anlass war dem Thema „Schwarzpeter und St. Florian“ gewidmet. Am Beispiel der ungeliebten Natel-Antennen diskutierten die Nationalrätin Ruth Humbel Näf aus Birmenstorf und der Ethiker Dr. Markus Huppenbauer, Lenzburg, über ethische Entscheidungsfindung im Spannungsfeld zwischen persönlicher Bequemlichkeit, wirtschaftlichem Druck und moralischen Konsequenzen.
Es hätte auch ein anderes Thema sein können, wie Gesprächsleiter Dr. Thomas Bornhauser, Studienleiter des Rügel, anfangs bemerkte. Autofahren und ruhig wohnen wollen, mit dem Flugzeug fliegen, aber bitte ohne Lärmbelästigung, und anderes mehr. Zutage tritt bei diesen Fragen das immer gleiche ethische Dilemma. Was ist wem in welchem Umfang zuzumuten?
Argumente oder Macht
Huppenbauer plädierte dafür, die unterschiedlichen Interessen und Werte bei der Entscheidungsfindung offen zu legen, um zu transparenten und ethisch verantwortbaren Entscheidungen zu kommen. Politiker, Telefongesellschaften, Anwohner von Sendeanlagen und schliesslich die Benutzer selber vertreten verschiedene Standpunkte. Wissenschaftliche Abklärungen helfen sie zu gewichten.
Zu einer „gerechten“ Lösung – da waren sich Referentin und Referenten einig – gehört auch das Vorsorgeprinzip. Wenn gesundheitliche Nachteile zu befürchten seien, hätte dieses Prinzip einen grösseren Stellenwert als rein wirtschaftliche Fragen. Ruth Humbel plädierte dafür, auch nur "subjektiv" empfundene Störungen ernst zu nehmen. Den Einwand, dadurch würden „Innovationen blockiert“, könne sie nicht unwidersprochen stehen lassen.
Alles nur eine "rein akademische Diskussion", wenn am Ende dann doch der wirtschaftlich und politisch Stärkere sich und seine Interessen durchsetze, wie Diskussionsleiter Bornhauser fragte. In einer pluralistischen Gesellschaft könne der Ethiker – so Huppenbauers Entgegnung – nur Entscheidungsgrundlagen anbieten. Die Entscheidungen selber träfen zwar andere, doch könnten ethische Fragen nicht einfach in Kommissionen „ausgelagert“ werden. Diese Gremien würden die Mächtigen vielmehr umso bewusster in die Verantwortung stellen.
Risikobereitschaft wenn man selbst bestimmt
Unbehagen aber auch aus staatspolitischer Sicht. Nationalrätin Humbel beklagte ein Demokratiedefizit, wenn technische Neuerungen ins Alltagsleben eindringen. Wenn die Bauvorschriften eingehalten werden, könne ein Gemeinderat nur noch ja sagen zur Bewilligung. Ein mögliches Nein der Anwohner hat kaum Auswirkungen. Es sei ein schwacher Trost, wenn es bei Abertausenden von Antennen „ganz demokratisch“ jeden irgendwo treffe. Hinzu komme die vielbeklagte Trägheit politischer Prozesse. Sie hinkten dem Leben oft hinterher.
Interessant sei allerdings, so Huppenbauer, welchen Neuerungen mit Skepsis begegnet werde und welchen nicht: „Die Mikrowelle steht in fast jeder Küche; bei Natel-Sendern regt sich der Protest. Dabei ist die Technik dahinter ähnlich. Nur könne in der Küche jeder selber über mögliche Risiken bestimmen; gefunkt hingegen wird ohne seine Zustimmung. Jedoch seien ihm viele ethischen Diskussionen zu technologielastig.“ Gravierender sei oft die Frage, wie sich Neuerungen auf unser Zusammenleben und unsere Kultur auswirkten, folgerte Huppenbauer.
Gemäss dem Schlussvotum der Referenten dürfe nicht immer wieder eine Bequemlichkeit über mögliche Bedenken triumphieren. Vielmehr müsse jeder einzelne die nur eigenen kleinen Vorteile gegen mögliche Nachteile für andere abwägen.
Quelle: Informationsdienst der Reformierten Landeskirche
Datum: 31.01.2005