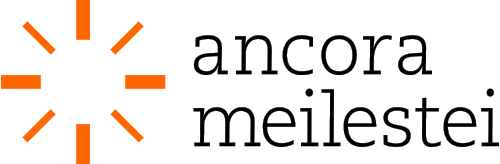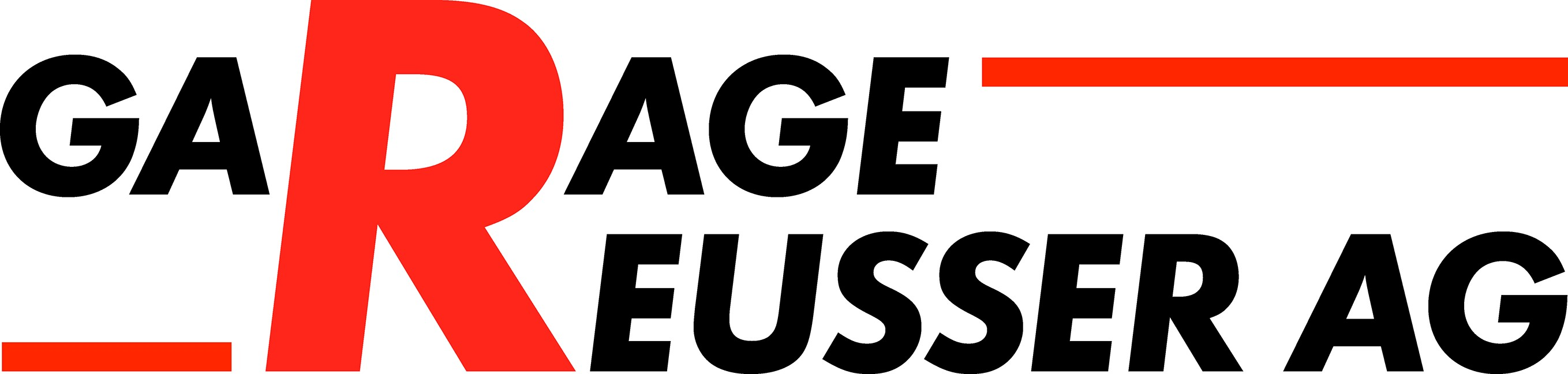Jesus Christus lebt. Allein die Tatsache, dass ich lebe und handle, ist Beweis dafür, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist.
Thomas von Aquin schreibt: »In jeder Seele ist ein Verlangen nach Glück und Sinnerfüllung.« Als Teenager wollte ich unbedingt glücklich werden. Das ist an sich nichts Verwerfliches. Ich wollte einer der glücklichsten Menschen der Welt werden. Und ich wollte den Sinn des Lebens finden. Darum suchte ich Antwort auf die Frage: »Wer bin ich?«, »Warum bin ich in dieser Welt?«, »Wo gehe ich hin?«
Vor allem aber wollte ich frei sein. Freiheit heisst dabei für mich nicht, dass ich tue, was ich will. Das kann fast jeder, und viele Leute tun es. Freiheit ist: »Die Kraft zu haben, das zu tun, was du tun musst oder solltest.« Die meisten Menschen sind sich zwar dessen bewusst, was sie eigentlich tun sollten, haben aber keine Kraft, es wirklich auszuführen. Sie sind gebunden. Ich versuchte, solchen Fragen auf den Grund zu gehen. Mir schien, dass jeder an irgendeine Religion glaubte, so tat ich das Nächstliegende und ging zur Kirche. Doch ich musste mich wohl in der Kirche geirrt haben. Viele von Ihnen werden ähnliche Erfahrungen gemacht haben: Es ging mir drinnen schlechter als draussen; obwohl ich morgens, mittags und abends zum Gottesdienst ging.
Ich war schon immer sehr praktisch veranlagt, und wenn etwas nicht klappt, mache ich Schluss damit. Ich habe also die Religion über Bord geworfen. Es war nichts dabei herausgekommen.
Ich versuchte, Ansehen zu gewinnen. In einer leitenden Position wollte ich mich mit einer Sache identifi zieren, mich ihr ganz widmen und dann damit »bekannt« werden – das erschien mir vielversprechend. An meinem ersten Studienort hatten die Studentensprecher das Sagen. Ich kandidierte für die Studentenvertretung. Man wählte mich auf Anhieb zum Sprecher der Erstsemester. Ich genoss es, von jedem gegrüsst und beachtet zu werden, das Geld der Universität und der Studenten auszugeben, Redner einzuladen, die mir gefi elen. Ich genoss es, aber nach einiger Zeit wurde auch dies langweilig wie alles andere, das ich versucht hatte. Gewöhnlich wachte ich am Montagmorgen mit schwerem Kopf auf und dachte: »Wieder fünf Tage bis zum Wochenende.« Alles Glück schien sich auf drei Abende der Woche zu konzentrieren: Freitag, Samstag und Sonntag. Dann begann der fatale Kreislauf von neuem. Sicher dachten alle in der Uni, mir ginge es bestens. Für den Wahlkampf hatten wir zum Beispiel den Slogan gewählt: »Josh wählen – Vergnügen haben.« Das war eine Anspielung darauf, dass ich mehr Partys mit weniger Geld veranstalten konnte als jeder andere. Keiner schien zu merken, dass mein Glück genauso oberflächlich war wie das der meisten anderen. Es war von den äusseren Umständen abhängig. Wenn alles gut lief, dann ging es mir gut. Wenn die Dinge schlecht standen, ging es mir ganz miserabel.
Ich war wie ein Boot, das von den Wellen hin und her geworfen wird. Es gibt einen guten biblischen-Ausdruck zur Beschreibung einer solchen Lebensweise – Hölle. Aber ich kannte niemanden, der anders lebte, und ich konnte auch niemanden finden, der mich mit einem anderen Lebenskonzept vertraut machen oder mir den Weg dahin zeigen konnte. Viele sagten mir, was ich tun sollte, aber niemand gab mir die Kraft dazu.
Ich begann zu verzweifeln. An meiner Universität fiel mir dann plötzlich eine kleine Gruppe auf: acht Studenten und zwei Dozenten, die irgendwie ganz anders waren. Sie schienen zu wissen, was sie glaubten und warum. So etwas beeindruckt mich, und es stört mich auch nicht, wenn sie mit mir nicht einverstanden sind. Selbst von meinen engsten Freunden stimmen einige in wichtigen Fragen nicht mit mir überein. Ich bewundere Menschen, die für ihre Überzeugung einstehen. (Leider treffe ich so wenige von ihnen.) Vielleicht fühle ich mich daher auch bei manchem Radikalen wohler als bei bestimmten Christen. Manche Christen verhalten sich so lau und unentschlossen, dass ich mich manchmal frage, ob die Hälfte von ihnen sich nur als Christen verkleidet hat. Jene kleine Gruppe an der Uni jedoch schien zu wissen, was ihr Ziel war. Das allein ist ungewöhnlich unter Studenten.
Ausserdem redeten diese Leute nicht nur über Liebe, sondern sie unternahmen selbst etwas. Sie schienen über die Zwänge des Universitätslebens erhaben. Ihr Glück hing offensichtlich nicht von den Umständen ab, sie schienen es aus einer inneren, ständigen Freudenquelle zu schöpfen. Dies beunruhigte mich, denn es war etwas, was ich nicht hatte und nicht kannte.
Wie die meisten Studenten wollte ich haben, was ich nicht hatte. (Deswegen muss man in der Uni auch sein Fahrrad abschliessen.) Bildung und Wissen geben keine Antworten auf Fragen der Moral, sonst wäre die Universität eine moralische Anstalt erster Ordnung.
Ich beschloss also, mich mit den Leuten anzufreunden. Zwei Wochen später sass ich dann mit sechs Studenten und zwei Angehörigen der Fakultät an einem Tisch. Wir kamen auf Gott zu sprechen. Unsichere Menschen tendieren dazu, den Überlegenen zu spielen, wenn solche Fragen auftauchen. Überall trifft man daher Menschen, die sagen: »Christentum – nur für Schwächlinge. Aber doch nichts für uns Intellektuelle.«
Meine Gesprächspartner machten mich unruhig, und so blickte ich schliesslich eine Studentin an, ein gutaussehendes Mädchen (bis dahin hatte ich gedacht, alle Christen seien hässlich). Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück, um möglichst unbeteiligt zu erscheinen, als ich fragte: »Was hat euer Leben so verändert? Warum unterscheidet sich euer Leben so sehr von dem der anderen Studenten und Professoren hier?«
Diese junge Frau muss sich ihrer Sache wirklich sehr sicher gewesen sein. Ohne eine Miene zu verziehen schaute sie mir direkt in die Augen und sagte zwei Worte, die ich an einer Universität am wenigsten erwartet hätte: »Jesus Christus.« Ich erwiderte: »Hör bloss mit diesem religiösen Gefasel auf. Religion ist für mich erledigt, Kirche ist für mich gestorben, die Bibel hängt mir zum Hals heraus. Von so was habe ich die Nase voll.« Sie schoss sofort zurück: »Ich habe nicht Religion gesagt, sondern Jesus Christus.« Damit gab sie mir etwas zu verstehen, was ich vorher nicht gewusst hatte. Das Christentum ist keine Religion. Religion ist der menschliche Versuch, sich durch gute »Werke« den Weg zu Gott zu bahnen. Christentum bedeutet dagegen: Gott kommt in Jesus Christus zu den Menschen und bietet ihnen eine Verbindung mit sich selbst.
Vielleicht gibt es an Universitäten noch mehr Missverständnisse und falsche Auffassungen vom Christentum als anderswo. Ich begegnete kürzlich einem Assistenten, der in einem Oberseminar erklärte: »Jeder Kirchgänger ist ein Christ.« Worauf ich erwidern musste: »Werden Sie gleich zum Auto, wenn Sie in eine Garage gehen?« Christ und Kirche sind zwei völlig getrennte Dinge. Ein Christ ist jemand, der sein Vertrau-en auf Jesus Christus setzt.
Meine neuen Freunde forderten mich auf, die Ansprüche Jesu auf Gottessohnschaft mit meinem ganzen Intellekt zu prüfen. Seine Fleischwerdung, sein Leben inmitten der Menschen auf Erden, seinen Tod am Kreuz für die Sünden der Menschen, dass er begraben wurde und nach drei Tagen wieder auferstand und dass er auch heute im 20. Jahrhundert das Leben eines Menschen verändern kann.
Ich hielt das alles für eine Illusion. Für mich waren die meisten Christen Träumer. Mir machte es Spass, auf das Wort eines Christen im Seminar zu warten, damit ich es dann anschliessend auseinander nehmen und den zu keiner Stellungnahme bereiten Professor herausfordern konnte.
Diese acht Leute jedoch waren für mich eine Herausforderung. Schliesslich ging ich darauf ein, aber nur aus Stolz, weil ich ihre Thesen widerlegen wollte. Aber ich hatte nicht mit Tatsachen gerechnet, mit Beweisen, die jeder Mensch selbst nachprüfen kann.
Schliesslich kam mein Verstand zu dem Ergebnis, dass Jesus Christus sein musste. Meine ersten beiden Bücher waren darauf angelegt, das Christentum zu widerlegen. Als mir das nicht gelang, wurde ich selbst Christ. Seit dreizehn Jahren schreibe ich nun über das Thema Glaube und Vernunft. Der Glaube an Jesus Christus ist mit der Vernunft vereinbar.
Zu Beginn hatte ich aber noch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Zwar sagte mir mein Verstand, was die Bibel berichtet sei wahr, aber mein Wille ging in eine ganz andere Richtung. Ich entdeckte, dass Christwerden das Ich fundamental erschüttert. Jesus Christus forderte auch meinen Willen auf, sich ihm anzuvertrauen. Nach Offenbarung 3,20 hörte sich das etwa so an: »Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen.« Mir war es aber ziemlich gleichgültig, ob er Wasser in Wein verwandelt hatte oder auf dem Wasser wandeln konnte. Ich wollte mich nicht mit einem Trauerkloss einlassen.
Jedesmal, wenn ich mit diesen begeisterten Christen zusammen war, begann der Kampf in mir von neuem. Wenn Sie schon einmal in einer fröhlichen Runde waren, als es Ihnen selbst schlecht ging, dann wissen Sie, was ich meine. Irgendetwas zog mich dorthin, aber am liebsten wäre ich dann sofort wieder hinausgerannt. Es kam so weit, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte. Entweder ich löste das Problem oder ich würde den Verstand verlieren. Schon immer war ich offen gewesen, aber jetzt war ich so offen, dass mir die berühmten kleinen grauen Zellen herauszufallen drohten.
Doch weil ich offen war, wurde ich am 19. Dezember 1959 um 20.30 Uhr abends während meines zweiten Jahres an der Universität Christ.
Wenn mich jemand fragt: »Woher weisst du das denn so genau?«, antworte ich: »Weil ich es selbst miterlebt habe. Es hat mein Leben verändert.« Ich betete in dieser Nacht. Ich betete um vier Dinge, um eine Verbindung mit dem auferstandenen, lebendigen Christus zu gewinnen, der seither mein Leben verändert hat.
Zunächst sagte ich: »Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist.« Und dann: »Ich bekenne dir die Dinge in meinem Leben, die dir nicht gefallen und bitte dich um Vergebung und Reinigung.« (Die Bibel sagt: »Wenn eure Sünden auch rot wie Scharlach sind, sollen sie weiss wie Wolle werden« Jes 1,18.) Drittens sagte ich: »In diesem Augenblick öffne ich dir so gut ich es kann die Tür zu meinem Herzen und meinem Leben und vertraue mich dir als meinem Erlöser und Herrn an. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Verändere du mich völlig. Mach aus mir den Menschen, als den du mich geschaffen hast.« Und mein letztes Gebet war: »Herr, ich danke dir, dass du durch den Glauben in mein Leben gekommen bist.« Mein Glaube gründete sich nicht auf Unwissenheit, sondern auf Beweise, auf geschichtliche Tatsachen und auf das Wort Gottes.
Sicher haben Sie schon religiöse Menschen über ihre »Erleuchtung« sprechen hören. Nach meinem Gebet passierte wirklich nichts. Nur dass ich mich noch schlechter fühlte. Mir wurde ganz elend zumute. »Auf was hast du dich da eingelassen, du bist ja verrückt«, sagte ich. Ich dachte tatsächlich, ich hätte den Bezug zur Wirklichkeit nun endgültig verloren.
Rückblickend kann ich jedoch sicher sagen: Ich hatte mich auf etwas Gutes eingelassen; das durfte ich während der kommenden anderthalb Jahre feststellen. Mein Leben veränderte sich. In einem Gespräch mit dem Leiter des Instituts für Geschichte an einer Universität im mittleren Westen äusserte ich, Gott habe mein Leben verändert. Er unterbrach mich und sagte: »Mc-Dowell, wollen Sie wirklich behaupten, im 20. Jahr-hundert hätte Gott Ihr Leben verändert? Auf welchen Gebieten denn?« Nach einer dreiviertel Stunde sagte er dann: »Danke, das reicht.«
Da war zum Beispiel meine Ruhelosigkeit. Früher musste ich immer beschäftigt sein. Wenn ich mal Zeit für mich hatte, besuchte ich entweder meine Freundin oder ging sonst wohin. Wenn ich durch die Uni stürmte, tobte in meinem Kopf ein Wirbelwind von tausend Fragen. Wenn ich mich hinsetzte und versuchte, zu studieren oder nachzudenken, gelang mir das nur schwer. Doch wenige Monate nach meiner Entscheidung für Christus stellte sich eine Art innerer Friede ein. Ich meine damit nicht, dass es plötzlich keine Konflikte und Kämpfe mehr gab. Es war keine Problemfreiheit, die ich fand, sondern die Fähigkeit, mit Problemen fertig zu werden. Und das möchte ich um nichts in der Welt mehr preisgeben.
Auch mein aufbrausendes Wesen hat Gott beruhigt. Ich liess mich sofort aus der Fassung bringen, wenn mich jemand nur schief ansah. Während meines ersten Semesters hatte ich mehrere Menschen tätlich angegriffen. Dieses Temperament war so sehr Teil meiner selbst, dass ich bewusst gar nicht erst versuchte, es zu ändern. Doch nach einiger Zeit musste ich feststellen, dass ich auch in gespannten Situationen wesentlich ruhiger reagierte.
Es gab noch etwas, was sich veränderte. Ich bin nicht stolz darauf. Wenn ich es erwähnte, dann deshalb, weil sehr viele Menschen damit zu kämpfen haben – die Quelle meines Wandels war die Begegnung mit dem auferstandenen, lebendigen Christus. Was ich meine, ist der Hass. Mein Leben lang hatte ich Hass empfunden. Oft war mir das äusserlich kaum anzumerken: Es nagte in mir. Menschen, Dinge, Aussagen konnten mich empören. Wie so viele war ich innerlich unsicher. Immer wenn ich jemandem begegnete, der anders war als ich, empfand ich ihn als Bedrohung.
Einen Menschen hasste ich mehr als alle anderen auf der Welt: meinen Vater. Für mich war er der stadtbekannte Säufer. Wenn Sie wie ich in einer kleinen Stadt wohnen und ein Elternteil Alkoholiker ist, dann wissen Sie, wovon ich rede. Meine Freunde in der Schule rissen ihre Witze über meinen Vater, der ihnen frühmorgens irgendwo in der Stadt entgegengetorkelt war. Sie dachten, es mache mir nichts aus. Ich lachte nach aussen hin mit, und innerlich schrie und weinte ich. Wenn er meine Mutter zusammengeschlagen hatte, fand ich sie nicht selten im Stall. Sie lag im Mist, unfähig, aufzustehen. Sobald Freunde uns besuchten, nahm ich Vater mit in den Stall, band ihn dort fest und parkte den Wagen in der Nähe des Silos. Unserem Besuch erzählten wir, er sei weggefahren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand. seinen Vater mehr hassen konnte als ich.
Nach meiner Entscheidung für Christus – etwa fünf Monate später, wurde ich durch Gottes Geschenk von einer Liebe durchdrungen, die mich selbst diesen Hass überwinden liess. Ich konnte meinem Vater in die Augen schauen und ihm sagen: »Vater, ich habe dich lieb.«
Und ich meinte es wirklich so! Nach alledem, was ich ihm vorher angetan hatte, verwirrte ihn das.
Etwas später hatte ich einen schweren Unfall. Ein Halswirbel war gebrochen, und ich wurde nach Hause abtransportiert. Niemals werde ich den Augenblick vergessen, als mein Vater den Raum betrat. Er fragte mich: »Kind, wie kannst du einen Mann wie mich lieben?« Worauf ich ihm erwiderte: »Vor sechs Monaten habe ich dich noch völlig verachtet.« Dann berichtete ich ihm, wie ich zu Christus gekommen war: »Vater, ich habe Christus in mein Leben aufgenommen. Ich kann es zwar nicht völlig erklären, aber als Ergebnis dieser Beziehung habe ich die Fähigkeit erhalten zu lieben, und kann nicht nur dich, sondern auch andere Menschen so annehmen, wie sie sind.«
Eine dreiviertel Stunde später erlebte ich eine der grössten Überraschungen in meinem Leben. Jemand aus meiner Familie, jemand, der mich so genau kannte, dass ich ihm nichts vormachen konnte, sagte mir: »Mein Sohn, wenn Gott bei mir tun kann, was er bei dir getan hat, dann möchte ich ihm die Gelegenheit dazu geben.« Dann betete mein Vater mit mir und vertraute sich Christus an.
Gewöhnlich brauchen solche Veränderungen Tage, Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre. Mein Leben änderte sich innerhalb von etwa anderthalb Jahren. Das Leben meines Vaters veränderte sich vor meinen Augen. Es war, als hätte jemand das Licht eingeschaltet. Niemals vorher oder später habe ich eine so schnelle Veränderung miterlebt. Seit dieser Zeit hat er nur noch einmal Whisky angerührt. Er führte ihn bis an seine Lippen, aber nicht weiter. Das war für mich der letzte Beweis: Jesus kann Menschenleben verändern.
Man kann über das Christentum lachen, es verspotten und in den Schmutz ziehen. Doch es funktioniert. Es verändert Menschenleben. Wenn Sie Christus vertrauen, sollten Sie Ihre Einstellungen und Ihr Verhalten genau beobachten. Denn Jesus Christus verändert Leben.
Das Christentum kann man niemandem überstülpen oder aufzwingen. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Ich kann nur weitergeben, was ich erfahren habe. Die Entscheidung bleibt jedem selbst überlassen.
Vielleicht hilft Ihnen das Gebet, das ich betete: »Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Vergib mir und reinige mich. In diesem Augenblick vertraue ich dir als Erlöser und Herrn. Mach aus mir den Menschen, als den du mich geschaffen hast. In Jesu Namen. Amen.«
Datum: 11.10.2006
Autor: Josh McDowell
Quelle: Wer ist dieser Mensch