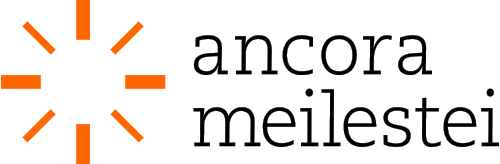An einem Caritas-Forum zum Thema "Sind wir eine Gesellschaft von Einsamen?" in Bern sagte Richter am Freitag vor rund 260 Teilnehmern, dass seit dem Ende der neunziger Jahre "die Visionen der Ich-Gesellschaft verblassen". Man wolle heraus aus dem Klima der sozialen Kälte, betonte der 81-jährige Wissenschaftler. Schon zum Millennium hätten die Befragten im Vergleich zu 1994 gesagt, dass sie sich wieder mehr Sorgen um andere machten, dass sie engeren Anschluss suchten, sich liebesfähiger fühlten und es leichter fänden, langfristige Bindungen einzugehen. "Es sieht also so aus, dass die Menschen in dem narzisstischen Rückzug auf das Ich nicht genügend Schutz gegen den Druck der ökonomischen Bedrohungen gefunden haben." Unter Einsamkeit versteht Richter "eine innere Befindlichkeit, aber auch einen Mangel an Bindungen der Menschen untereinander, ein soziales Klima, das die Menschen voneinander isoliert, das sie vereinsamen lässt". Gemäss Richter spüren die Menschen angesichts der wachsenden Gefährdung der Arbeitsplätze und der Verzichte, die zur Erhaltung der Betriebe, der Sicherung der Renten und der Gesundheitsversorgung notwendig sind, dass sie mehr zusammenrücken müssen. Es scheine, als sei die schreckliche Südasien-Katastrophe wie ein Signal begriffen worden, die Zusammengehörigkeit aller Menschen auf der Erde durch praktisches Helfen zu beherzigen. Getroffen worden seien die Schwächsten, aber auch die Reichen in ihren Ferienparadiesen. Und für den Friedensaktivisten Richter ist gewiss: "Wenn die Amerikaner jetzt das am schwersten getroffene islamische Sumatra engagiert unterstützen, treten sie dem islamischen Terror wirksamer entgegen als durch Kriege, die das Übel noch verschärfen." Diese Wiederbesinnung auf das Soziale bleibt allerdings laut Richter noch weit zurück hinter der Strömung der siebziger Jahre, als etwa in den USA die freiwilligen Einsätze von Studenten innert zehn Jahren auf das Achtzigfache anstiegen. Aber es sage heute in den Ländern der EU eine Mehrheit der Befragten: "Es ist wichtiger, dass niemand in Not gerät, als dass die Einzelnen ihre Ziele frei von Regierungseinmischung verfolgen können." Die Mehrheit der US-Amerikaner sei der umgekehrten Meinung. Diese finde auch, dass die wohlhabenden Länder schon zu viel für die Armen anderer Länder ausgeben. Dagegen wollten fast 70 Prozent der Europäer für den gleichen Zweck mehr aufwenden. Und bei einer Umfrage der Europäischen Kommission nach Wertvorstellungen stehe bei 95 Prozent der Europäer an erster Stelle: "Anderen helfen." Gemäss der Soziologin Elisa Streuli, Dozentin an der Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel, hat sich der Charakter der Einsamkeit in der Schweiz verändert: "War früher das Einsamkeitsrisiko ein Ausdruck von unabänderlichen Gegebenheiten, von Abhängigkeiten und rigiden sozialen Kontrollen, so ist es heute ein Ausdruck der Orientierungslosigkeit und des persönlichen Scheiterns an der so genannten Freiheit." Die Jagd nach den vielfältigen Optionen lasse scheinbar kaum mehr Zeit für Sozialkontakte, für Musse und Anteilnahme am Leben anderer. Elisa Streuli erinnerte daran, dass soziale Kontakte nicht nur durch die Rolle bestimmt seien, sondern in erster Linie durch die Person. Für gute Sozialkontakte brauche es eigentlich nicht viel: Zeit und die Bereitschaft, zuzuhören und sich auf andere einzulassen. Ein 15-jähriger Bursche habe kürzlich einem Strassensozialarbeiter gesagt, so wie er habe ihm sein Vater in seinem ganzen Leben noch nie zugehört. Die Soziologin betonte: "Zeit haben, sich Zeit nehmen, Anteil nehmen sind zwar individuelle Merkmale, sie werden jedoch durch geeignete gesellschaftliche Rahmenbedingungen gefördert." Die Isolation in der Arbeitswelt war das Hauptthema des Genfer Nationalrates und Vizepräsidenten der Grünen, Ueli Leuenberger. Heute hätten viele Angestellte das Gefühl, nichts als eine Nummer zu sein, sagte er. Ursachen dafür seien die Anonymität der Entscheidungsträger und Besitzer von Unternehmen, der Mangel an gemeinsamen Projekten und die Angst vor der Zukunft. Martin Kronauer, Professor für Gesellschaftswissenschaft an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin, zeigte in seinem Referat auf, dass etwa Langzeitarbeitslose im persönlichen Umfeld häufig mit anderen Arbeitslosen zusammenträfen, während beruflich stabil Verankerte in erster Linie mit Menschen in ähnlich stabiler Lage zu tun hätten. «Die problematischen Folgen dessen liegen auf der Hand. Ungleichheiten am Arbeitsmarkt und im Beschäftigungssystem werden demnach durch soziale Beziehungen der Tendenz nach weniger ausgeglichen als vielmehr reproduziert, wenn nicht gar in einer Negativspirale verstärkt.»Menschen spüren, dass sie zusammenrücken müssen
Wiederbesinnung auf das Soziale
Scheitern an der Freiheit macht einsam
Gute Sozialkontakte brauchen nicht viel Zeit
Isolation in der Arbeitswelt
Datum: 18.01.2005
Quelle: Kipa