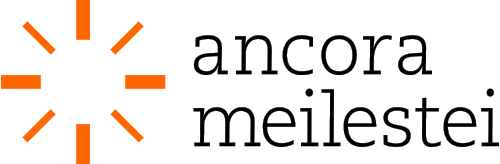„Wir müssen zurückfinden zu einem verständlichen Kirchesein“
Livenet.ch: Was tun Sie im SEK, um Beziehungen zwischen den Schweizer Protestanten und reformierten Christen weltweit zu stärken?
Gottfried W. Locher: In meiner Wahrnehmung tun wir als kleines reformiertes Land überproportional viel. Das Bullinger-Jahr ist ein viel wichtigeres Zeichen als eine bloss akademische oder historische Angelegenheit. Nicht zufällig kamen an dieses Jubiläum kirchenleitende Persönlichkeiten aus vielen reformierten Kirchen, bis hin nach Korea. Wir haben rumänische, deutsche, englische Kirchenleitungen und den Generalsekretär des Reformierten Weltbunds eingeladen. Im Bullinger-Jahr geht es auch darum zu zeigen, dass wir mit einer gemeinsamen Tradition zu einer gemeinsamen Kirche zusammengehören.
Andere reformierte Kirchen haben ein Bischofsamt. Sie haben das für die Schweizer Reformierten auch angeregt und ungewöhnlich heftigen Widerspruch provoziert. Wie begründen Sie die Anregung? Woran leiden wir? Wohin wollen Sie?
Ich habe mich in der Reformierten Presse ausführlich über die Gründe für die Debatte ausgelassen. Man kann es zusammenfassen unter dem Begriff der geistlichen Stimme. Jede Gemeinde hat einen Pfarrer oder eine Pfarrerin mit dem Auftrag, geistlich in diese Gemeinde hinein zu sprechen, und daneben eine Kirchenpflege bzw. einen Kirchgemeinderat, der die übrigen Leitungsaufgaben erfüllt.
Auf der Ebene der Kantonalkirchen haben wir das in meiner Wahrnehmung eben nicht. Die Öffentlichkeit braucht heute auf allen Ebene eine geistliche Stimme, nicht nur auf der Ebene der Gemeinde, sondern auch gesamtkirchlich.
Wir haben zwar z.B. in Zürich und Bern Ämter (Kirchen- bzw. Synodalratspräsident) mit bischöflichen Elementen, aber sie sind strukturell derart eingeschränkt, dass nicht zum Zug kommt, was dringend nötig wäre, nämlich die Freiheit, eine geistliche Position zu vertreten, die nicht schon kirchenpolitisch immer schlüssig sein muss. Darum dann hören wir meistens eine ausgewogene, mehrheitsfähige, politisch abgestimmte Position, die die Zusammensetzung der kantonalen Kirchenleitungen widerspiegelt.
Die zweite Notwendigkeit ist die Leitung und Begleitung der Ordinierten. Mir wird immer wieder vorgeworfen, das sei hierarchisches Denken. Ich höre das und denke, dass wir Hierarchien an vielen Orten hinnehmen, mit Gewinn. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Pfarrerin und mancher Pfarrer, der vielleicht manchmal einsam in seinem Gemeindeamt sitzt, allenfalls noch Streit hat mit seinem Kollegen, froh wäre, wenn die geistliche Leitung, aber auch die Einführung eines jungen Pfarrers ins Amt, stärker wahrgenommen würde von der Gesamtkirche.
Der Dekan kommt eigentlich nur in Konflikten ins Spiel…
Ja, man könnte sehr viel mehr tun. Es müsste wohl einhergehen mit einer Stärkung des Amtes. Da höre ich dann auch wieder von links und rechts den Aufschrei: Wir sind doch keine Amtskirche. Wir haben doch das Priestertum aller Gläubigen. Ich glaube einfach, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ein Extrem verfallen, in dem alle für alles verantwortlich gemacht werden und somit niemand für nichts verantwortlich sein wird.
Wir erleben und denken in der Schweiz Kirche von unten, von der Ortsgemeinde her. Landeskirche kennen wir, vom Kirchenbund wissen wir noch. Und wir fragen: Was sollen die internationalen, weltweiten Verbindungen? – Gottfried Locher, wie sehen Sie den Reformierten Weltbund und den Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf?
Wir brauchen keine Hierarchisierung der Kirche. Wir wollen an dieser Eigenheit festhalten, dass reformierte Kirche Kirche von unten ist. Aber was wir brauchen, ist – ich kehre es um – eine Verkirchlichung der Hierarchie. Wir haben allerlei Dachverbände und Lobby-Organisationen und weltweite Zusammenschlüsse. Aber die sind ja bis jetzt nicht Kirche geworden.
Und ich meine, wir müssen unser Subsidiaritätsprinzip (Nach-oben-Geben von Kompetenzen nur wo nötig) jetzt insofern ernst nehmen, als wir aufhören zu sagen: Kirche ist Gemeinde, allenfalls ein wenig Landeskirche, sicher nichts sichtbar weltweit Umfassendes. Diese Zeit ist in der Kirche definitiv vorbei. Sie ist ja in unserem Berufsleben längst vorbei. Die wenigsten Unternehmen funktionieren noch nur lokal. Die Globalisierung des Lebens beobachten wir auch in der Kirche.
Das heisst nicht, dass nicht die Basis entscheidend ist. Am Anfang und am Schluss geht es in der Kirche um die Menschen an der Basis, jene, die miteinander Predigt hören, taufen, Abendmahlfeiern, im Alltag leben. Aber es gibt nicht mehr viel, was nicht auch noch eine globale Dimension hat. Fast überall müssen die globalen Elemente mitbedacht werden, wenn wir für die Schweiz einen Entscheid treffen.
Ein Beispiel: Es ist nicht möglich, in der Abendmahlsdiskussion, die ja dann an der Basis zu Spannungen oder zu Versöhnung führt, eine Lösung zu finden, wenn wir das nicht auf einem mindestens europäischen Niveau theologisch angehen können. Es ist nicht so, dass es einen nachhaltigen Fortschritt gibt an der Basis, wenn nicht auch Traditionen miteinander versöhnt werden können. Nach einigen Jahren in der internationalen Ökumene sehe ich, dass Ökumene von unten und Ökumene von oben miteinander gehen müssen, sonst gibt’s den ökumenischen Stillstand.
Stünde denn nicht ein nächster Schritt an in der Schweiz: nämlich dass wir aufhören, in jeder Gemeinde, in jedem Dörflein mindestens zwei Kirchen zu unterhalten, beide nur mässig gut besucht? Wenn man sich vorstellt, dass wir uns in unserer säkularisierten, multireligiösen Gesellschaft den Luxus leisten, zwei (und mehr) verschiedene christliche Organisationen aufrecht zu erhalten, inklusive Immobilien und Lohntüten – dann frage ich mich, ob das noch irgend einen Sinn macht.
Deshalb müssen wir ein Interesse daran haben, uns einander näher zu bringen. Und dieses Näherbringen geschieht, indem wir auch auf geografisch umfassenderen Ebenen miteinander sprechen – nicht in Konkurrenz zur Basis, sondern in Ergänzung dazu.
Derzeit kommen Christen zweimal oder dreimal jährlich zu ökumenischen Gottesdiensten (auch Allianzgottesdiensten) zusammen.
Vermutlich haben wir eine leicht verklärte, romantisierte Vorstellung von dem, was in der Ökumene möglich ist. Das ist eine schweizerische Eigenheit, die sich möglicherweise noch in Teilen Deutschlands findet – und dann ist Schluss. In der übrigen Welt, jedenfalls wo ich Einblick erhielt, gibt man sich weniger der Illusion hin, dass zwischen römischem Katholizismus und Protestantismus eine Versöhnung einfach an der Basis stattfinden werde.
Ich nehme eine gegenteilige Entwicklung wahr. Wir erleben eher den Versuch der grossen alten West- und Ostkirchen, miteinander näher in Kontakt zu kommen. Mit der katholischen und den orthodoxen Kirchen verhält sich wie beim Streit von Brüdern oder Schwestern: Die streiten sich so viel, weil sie einander so nahe sind. Die geraten sich in die Haare, weil sie sich eben gleichen. Und weil sie jetzt, wo politische Schranken gefallen sind, auch wieder viel mehr Kontakt miteinander haben können, einander auch konkurrenzieren.
Aber es gibt doch wesentliche Aussagen, zum Beispiel vom zuständigen Römer Kardinal Kasper, der sagt, dass sich die Ost- und die Westkirche dogmatisch nie voneinander entfernt hätten. Jetzt kommt so etwas wie eine pragmatische Annäherung. Das lässt mich aufhorchen. Katholiken und Orthodoxe sprechen einander als Schwesterkirchen an. Es sind auch die beiden, die sagen: Ausser uns gibt es keine Schwesterkirchen. Sie sind sich beide einig in der Meinung, dass wir Protestanten ganz sicher nicht Kirche sind.
Wie gehen Sie damit um?
Ich habe heute weniger Hemmungen, über Tabus wie etwa das Bischofsamt zu sprechen, weil ich glaube, wir müssen zurückfinden zu einem verständlichen Kirchesein. Wir sind nicht irgendein Verein. Wir sind die Gemeinschaft der Heiligen in der Nachfolge Jesu Christi. Entweder machen wir das glaubwürdig im Alltag und auch mit unserer Stimme – oder wir sind irrelevant und Kirche findet woanders statt. Dass Kirche stattfindet, darum habe ich keine Angst. Die Frage ist nur, ob wir auch daran teilnehmen.
Und das Daran-Teilnehmen hat schon damit zu tun, dass wir uns konzentrieren auf Wort und Sakrament. Ich betone angesichts unserer Tradition extra auch Sakrament. Es ist ein Fehlschluss zu meinen, Kirche geschehe nur über den Kopf und das Wort. Kirche hat immer auch den Aspekt des Erlebnisses, des Geheimnisses, der Liturgie gehabt.
Wer in ökumenischen Angelegenheiten zu tun hat, sieht, welcher Reichtum in dieser Liturgie auch steckt. So können wir Reformierte beitragen, dass man das Wort und die Theologie nicht vergisst; andere tragen dazu bei, dass man die Liturgie, das Geheimnis, das Sakrament nicht vergisst. Aber es braucht jetzt Fortschritte. Und auf unserer Seite braucht es – ich weiss, es ist ein Modewort – eine Profilierung.
Doch Christen und auch kirchenleitende Persönlichkeiten schwimmen meistens mit in der Gesellschaft, so dass sie zuwenig Profil haben und den Menschen das Reich Gottes nicht mehr als etwas qualitativ Besseres deutlich machen können. Die reformierte Kirche, hat man den Eindruck, passt sich ein in ein immer säkulareres kulturelles Klima…
Ich wäre vorsichtig, von Selbstsäkularisierung zu sprechen. Säkularisierung geschieht, aber ob wir es selber tun, weiss ich nicht. Ich nehme einfach wahr, dass unsere Kirchen domestiziert wurden. Sie sind in Zürich und Bern stark mit dem Staat verhängt, abhängig vom Staat. Der Staat kürzt Ausgaben, und in meinem Kanton Bern werden dann Pfarrstellen abgebaut.
Unsere Landeskirchen haben sich geschichtlich innerhalb der politischen Strukturen entwickelt. Das hatte viele Vorteile: Man konnte das Volk ansprechen. Ich glaube auch, dass es den Kirchen gelungen ist, die Gesellschaft zu prägen mit christlichen Werten.
Jetzt stellt sich aber die Frage: Wie gehen wir heute damit um, dass die Gesellschaft von anderen Werten, Glaubensüberzeugungen und Ideologien durchdrungen wird? Die Schweiz ist ja keine Insel.
Ich bin in der Tat der Meinung, die Kirche müsste sich aus allerlei Zwängen wieder herausnehmen. Sie müsste versuchen, ihre Ausrichtung auf die Nachfolge Jesu Christi ernster zu nehmen, indem sie – etwa durch das Bischofsamt, ich wiederhole mich – geistlich spricht in der Gemeinde, als Kirche, als Kirchenbund und als weltweite reformierte Kirche.
Sie müsste wieder laut sagen: Gottesdienst ist nicht eine von verschiedenen kirchlichen Aktivitäten. Gottesdienst ist dort, wo die Kirche beginnt. Aus dem Gottesdienst heraus, aus diesem Zentrum von Wort und Sakrament heraus, geschieht dann Diakonie, geschieht Theologie auch. Und es geschehen andere, wichtige Handlungen der Kirche. Aber es gibt ein Zentrum. Und das Zentrum des Kircheseins ist die Vermittlung von Jesus Christus – durch den Heiligen Geist, im Wort und im Sakrament.
Eigentlich ist es einfach. Wir sollten die Stimmen nicht nur der Freikirchen, sondern vielleicht auch unserer ökumenischen Geschwister ernster nehmen. Es geht darum, die Sache beim Namen zu nennen. Es geht um Bibel, es geht um persönliche und gemeinsame Nachfolge. Um Predigt, um Abendmahl und Taufe, um Bekenntnis, dann aber vor allem auch um Kirchesein im Alltag. Es ist nicht so schwierig, das zu verstehen. Es ist etwas schwieriger, auch entsprechend zu handeln.
Gottfried W. Locher über den Reformator Bullinger und die Reformierten heute:
www.livenet.ch/www/index.php/D/article/189/16842/
Livenet-Dossier über Bullinger und die reformierte Kirche:
www.livenet.ch/www/index.php/D/article/493/19081/
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund:
www.sek-feps.ch
Reformierter Weltbund:
www.warc.ch/
Datum: 03.11.2004
Autor: Peter Schmid
Quelle: Livenet.ch