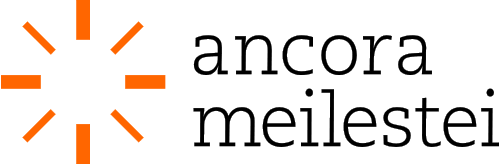Junge Christen im Kulturwandel
Livenet: Wie erleben Sie den Kongress?
Trev Gregory: Ich kann mich nicht an einen anderen Kongress erinnern, bei dem so viele Teilnehmer sich echt geistlich engagierten. Hier lässt sich die Mehrheit von Jesus bewegen durch das Programm. In den meisten Veranstaltungen, auch von Kirchen, setzen sich die Leute im hinteren Teil hin, um zu sehen, was geschieht. Hier ist es anders. Ich gehe während jeder Plenarveranstaltung durch die Halle, an den Sitzreihen vorbei, um zu sehen, was passiert. Und: jede und jeder ist dabei. Beim Lobpreis, beim Hören auf die Botschaften und Wahrnehmen all dessen, was sonst geschieht.
Die Seminare waren noch nie so populär nach den Echos, die wir empfangen. Wenn diese Vorträge am Nachmittag gehalten werden, ist es in der Ausstellung der Missionswerke fast unheimlich ruhig – weil alle in den Seminaren sitzen. Da geschieht etwas mit dieser Gruppe junger Leute, das mich begeistert.
Die Teilnehmer wollen sich informieren.
Ja. Sie sind begierig nach Information. Ein Aussteller kam zu mir; er zeigte sich erstaunt über die unglaubliche Tiefe der Gespräche, die er mit Besuchern führt. Sie fragen nicht nur, was seine Organisation tut, sondern wollen wissen, was sie beitragen können. Wir sehen diesmal noch deutlicher als vor zwei Jahren, dass immer mehr junge Leute einen ersten Gang durch die Ausstellung machen und sich die Internet-Adresse merken. Im Cyber-Café, das wir eingerichtet haben, lesen sie sich durch die Webseiten. Und erst dann entscheiden sie, ob sie nochmals hingehen und wirklich das Gespräch suchen. Und dabei stellen sie aufgrund ihres Wissens präzise Fragen. Ein Aussteller, der in Argentinien arbeitet, sagte mir, junge Teilnehmer hätten aus seiner Webseite wörtliche Zitate angeführt.
In den letzten Jahren haben Missionswerke Mühe bekundet, Menschen für einen lebenslangen Einsatz zu gewinnen. Für einige Monate, ein Jahr oder zwei mögen sich viele verpflichten, aber dann wollen sie ins normale Leben zurückkehren. Ist dieser Trend für Sie eine grosse Herausforderung?
Ich denke, wir müssen den kulturellen Wandel in Europa sehen. Die Generation meines Vaters hatte eine Stelle auf Lebenszeit. In meiner Generation durchlaufen Arbeitnehmer im Durchschnitt vier verschiedene berufliche Karrieren. Nicht vier Arbeitstellen, sondern Karrieren – nach EU-Statistiken. Vor einer Generation war eine Karriere der Normalfall.
Dies wirkt sich in der christlichen Missionsarbeit aus. Wir haben Leute, die einen Zeitrahmen von zwei, drei, vier oder vielleicht sechs Jahren für ihr Engagement setzen. Andererseits gibt es Leute, die eben dies tun, dann zurückkommen, einen Job in der Wirtschaft antreten und später erneut ausreisen – vielleicht nicht mit derselben Organisation.
Am letzten Kongress traf ich ein Paar aus der Schweiz, das im Mittleren Osten gearbeitet hatte, dann zurückgekehrt war, drei oder vier Jahre arbeitete und so die Mittel für einen weiteren Einsatz ansparte. Sie nahmen vor zwei Jahren am Kongress teil, um eine andere Organisation zu finden und zu erkennen, wo Gott sie im zweiten Einsatz haben wollte. Ich nenne dies ‚mission-dipping’: Wir gehen, sagen diese Leute, vorerst für 3-4 Jahre, dann kommen wir zurück, verdienen – und reisen dann wieder aus.
Vielleicht nimmt diese Generation ihre Verantwortung eher wahr als frühere Christen. Bisher hegten die meisten Missionare die Erwartung, von ihrer Gemeinde, ihrer Familie und Freunden finanziert zu werden. Doch nun sehe ich bei jungen Christen zunehmend die Bereitschaft, selbst zu den Finanzen beizutragen. Denken Sie an den Lebensstil der ‚Zeltmacher’, der sich sehr rasch verbreitet. Es gibt immer mehr Missionare, die (wie einst der Apostel Paulus mit seinem ersten handwerklichen Beruf) an ihrem Einsatzort Geld verdienen. Manche wollen nicht völlig von ihren Freunden oder der Organisation abhängig sein.
Wir müssen die Trends sehen, ob sie uns gefallen oder nicht. Diese Trends begannen in unseren Gemeinschaften, die auseinandergebrochen sind. Der Wandel in der Arbeitswelt führt zu einer anderen Arbeitsmentalität in Europa. Und wer will sagen, wie die nächste Generation sich entwickelt? Immer mehr Leute können fernab ihres Büros arbeiten, denn auch zu Hause haben sie einen schnellen Internet-Anschluss. Was heisst das für Zukunft die Missionsorganisationen? Brauchen wir weiterhin grosse Büros oder können wir uns zerstreuen und übers Internet zusammenarbeiten? Ich weiss nicht.
Ich denke, die Werke müssen aufwachen und den Wandel sehen, verstehen, was im Gange ist. Und überlegen, wie wir uns anpassen sollen. Andernfalls werden noch mehr Missionswerke von der Bildfläche verschwinden. Und das ist auch ein Trend – weil sie sich nicht bewegen, sich nicht wandeln. Sie verschwinden.
Sie sterben…
Ja, genau. Der Managment-Berater Peter Drucker spricht von einem Umbruch, der so radikal ist wie damals der Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft. In diesem Prozess wandelte sich auch die Landwirtschaft völlig; so nahm etwa die Grösse der Betriebe zu. Wir haben heute einen ähnlich radikalen Kulturwandel. Aber die Kirchen und Missionswerke zögern...
Sind junge Leute in ihrer Bereitschaft für einen Einsatz den Missionswerken manchmal voraus?
Ja – und das ist schon immer so gewesen. Das ist gar nichts Neues. Die Jungen von heute reflektieren unsere Kultur, zeigen uns, wo sie steht. Vor 40 Jahren nahm George Verwer, als er ‚Operation Mobilisation’ gründete, in einer christlichen Weise Bezug auf die ganze Hippie- und Freedom-Bewegung. Sie können in der Kirchengeschichte weiter zurückgehen. Nikolaus Graf Zinzendorf reagierte mit seinen Gründungen auf die Zustände in europäischen Kirchen im 18. Jahrhundert.
Ein anderes Stichwort: Junge Europäer geben sich als Individualisten. Wie erleben Sie dies – und setzen Sie dem Individualismus etwas entgegen?
Junge Leute sind widersprüchlich. Sie glauben gleichzeitig zwei Dinge, die sich ausschliessen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Postmoderne. Ja, natürlich sind sie individualistisch – aber zur selben Zeit wollen sie neu bestimmen, was Gemeinschaft ist. Früher war Gemeinschaft örtlich begrenzt. Heute aber kann ich mit weit entfernten Menschen, Freunden am Ende der Welt, in Beziehung stehen, ja diese Beziehung pflegen. Junge Leute nehmen ihren Laptop – und damit ihr Beziehungsnetz – mit an den Missionsort. Sie können sich, wo immer sie sind, jeden Tag mit ihren Freunden austauschen.
Und dabei sind sie durchaus individualistisch gestimmt. Sie wollen zwar Gemeinschaft, auf ihre, neue Weise streben sie sie an, suchen aber dabei ihre eigene Identität, fragen: Wer bin ich? In der modernen Gesellschaft war dies ein unmöglicher Widerspruch – heute, in der Postmoderne, lebt man damit.
Ein weiterer Punkt, den ich wahrnehme: Junge Leute wollen nach ihrer Persönlichkeit, nach ihrem Wesen beurteilt werden, nicht zuerst nach dem, was sie für andere leisten können oder was man aus ihnen herausholen kann. Noch in meiner Generation haben die Menschen ihren Selbst-Wert mehr über das, was sie für andere tun, bestimmt und andere nach ihren Leistungen beurteilt. Die Jungen heute, ob Christen oder Nicht-Christen, haben ganz andere Werte. Sie fragen: Akzeptierst du mich, wie ich bin? Das ist ihre Frage.
Wenn wir die Frage richtig beantworten, fühlen sie sich zur Gemeinschaft hingezogen. Denn sie suchen Beziehungen. Wenn wir aber falsch antworten und erst mal einen Haufen Verhaltensregeln und Vorschriften aufstellen, dann wenden sie sich ab, verweigern sich den Forderungen, weil sie sich nicht angenommen fühlen.
In der Postmoderne, unter diesen jungen Christen, sehe ich ein grösseres Gespür, wohl unbewusst, für biblische Werte wie Gnade, Annahme und Vergebung als in vielen anderen Generationen.
Und zugleich fordern Sie diese Leute hier am Kongress auf, ihr Leben hinzugeben, ihre Freiheit, ihr Ego zu opfern für die Sache von Christus…
Ja, absolut. Denn es gibt auch die Kehrseite: Sehen Sie Fernsehproduktionen wie ‚Big Brother’ – da wird jeder eine Berühmtheit. Dies zu opfern, den Wunsch nach Bekanntheit oder Ruhm zu opfern, das Sehnen nach Reichtum und Ansehen aufzugeben – das kostet etwas. Aber die jungen Leute, mit denen wir es hier zu tun haben, kennen Schmerz – weil sie selbst Ablehnung, Zurückweisung erfahren haben. Manche kommen von beschädigten Familien. Sie wissen, was es heisst, allein zu sein. Und mit alledem fragen sie: Akzeptierst du mich, wie ich bin?
Wenn ich dies sehe, glaube ich, dass christliche Missionsarbeit eine grosse Zukunft hat. Wenn wir nur von der Bibel her klar machen können, worum es dabei geht und wie Christen leben können. Es geht um Demut – nicht Erfolg. Um Gnade und Vergebung – nicht herumzutrampeln auf dem, der dir was angetan hat.
Bei diesen jungen Leuten haben wir eine grosse Chance. Sie sind offen. Wir können Grundlagen legen, die die Haltung der Kirche radikal verändern werden. Die Kirche im Westen, in Europa, ist zu lange an der Macht gewesen. Wir wachen nun auf und merken, dass wir sie verloren haben. Politische Macht – ist weg. Einfluss in unseren Staaten – ist weg. Und das ist gut so. Denn als Christen waren wir nicht berufen, politische Macht auszuüben.
Unser Auftrag ist es, die Gnade, die Christus uns geschenkt hat, weiterzugeben. Da geht es um Annahme, Vergebung, Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit, die wir erfahren haben, sollen wir anderen zeigen. Nicht auf ihnen herumtrampeln, um auf der Karriereleiter aufzusteigen. Sondern hingehen und uns zu denen setzen, die Mangel haben.
Hier am Kongress fallen die Südeuropäer besonders auf; sie machen Stimmung...
Wir haben Teilnehmer aus über 40 Ländern, 40 verschiedenen Kulturen. Da sind die Spanier, die zusammen singen und tanzen. Die Norweger mit ihren Fahnen und die Schweizer. Die Jugendlichen bringen ihre nationale Eigenart zum Ausdruck. Das ist höchst interessant.
Jemand erzählte mir, wie ein Holländer und ein Albaner versuchten, einander zu verstehen. Eine gemeinsame Sprache fanden sie nicht; so verständigten sie sich mit Zeichen – und begannen, voneinander zu lernen. Das fasziniert mich. Barrieren verschwinden, Vorurteile und Verdächtigungen lösen sich auf – und über Grenzen hinweg wachsen Freundschaften.
Weitere Interviews und Berichte folgen.
Datum: 06.01.2004
Autor: Peter Schmid
Quelle: Livenet.ch