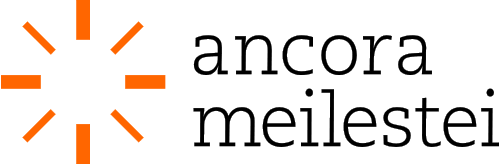„Man darf die Kirche nicht ständig religiös auf Turbo fahren“
Livenet.ch: Samuel Lutz, Sie haben seit 1995 als Synodalratspräsident die reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn geleitet. Sie ist mit 650'000 Gliedern die grösste evangelische Landeskirche der Schweiz. Doch auch sie schrumpft.
Samuel Lutz: Wir haben derzeit 2300 Taufen jährlich und 7000 Abdankungen. Dazu kommt die Abwanderung.
Die tiefe Geburtenrate der Reformierten führt dazu, dass in zwei Generationen statt zehn noch drei oder vier Frauen Kinder haben können. Warum?
Schwer zu sagen, ohne dass ich urteile. Im reformierten Milieu gehört die Grossfamilie der Vergangenheit an. Die Scheidungsrate ist verhältnismässig hoch und es gibt Lebensphasen, in denen die Leute keine Kinder haben wollen.
Die Reformierten haben doch eine lebensbejahende Spiritualität. Warum sind heute viele nicht mehr willens, ihr Leben mit Kindern zu teilen?
Die Kinder, die geboren sind, haben es gut bei uns – ich erinnere an die Initiative der Familienkirche. Allerdings ist der Individualismus im Protestantismus sehr stark ausgeprägt – und weil er dem Einzelnen viel Freiheit lässt, prägt ihn die Gesellschaft stärker.
Der reformierte Protestantismus wird zahlenmässig kleiner werden, aber als eigenständige Ausprägung des christlichen Glaubens und seiner Ethik nicht verschwinden. Wir lernen auch im Kanton Bern, dass wir die Kirche nicht allein quantitativ verstehen sollen, sondern von ihrem Selbstverständnis und Auftrag her. Wie geht eine kleiner werdende Kirche in ihre Zukunft? Das ist die wichtigste Frage.
Neben der quantitativen Abnahme ist eine innere Erosion wahrnehmbar. Was sagen Sie dazu, dass Schweizerinnen und Schweizer Auferstehung und Reinkarnation (Wiedereinkörperung der Seele für ein nächstes Leben) verwechseln? Sie bereiten sich nicht mehr darauf vor, nach diesem Leben Jesus, dem auferstandenen Herrn, zu begegnen.
Die Menschen suchen nach einer Spiritualität, ohne sich an eine theologische Lehre zu halten. Sie verlangen nach einem Glauben; Rechtgläubigkeit ist ihnen dabei nicht wichtig, sondern ihr eigenes Erleben. Die Kirche hat sich dem geöffnet. Wir müssen aber theologisch darüber wachen, was spirituell alles geschieht. Zur Auferstehung: Als Pfarrer habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute die Auferstehung mit der Unsterblichkeit der Seele verwechseln. Als ich in einer Predigt darauf hinwies, kam es nicht gut an.
Traditionell versteht sich die Kirche als Institution, die dem Glauben Leitlinien gibt.
Im Protestantismus haben wir kein Lehramt. Wir schreiben den Leuten den Glauben nicht vor – das betone ich weiterhin. Bei Zwingli habe ich immer wieder gelesen, dass der wirkliche Glauben eine Gabe des Heiligen Geistes im Herzen des Menschen ist. Wie er dann in seinem Kopf darüber denkt und was er damit macht – ob er mit Kerzen spielt oder eine zweite Taufe will –, dazu haben wir zwar kirchliche Ordnungen, zu denen wir Sorge tragen. Entscheiden aber müssen die einzelnen Menschen selber.
Seit Zwingli hatten wir Aufklärung, Idealismus und Existentialismus…
…und stehen daher heute mit dem Individualismus, der Selbstverwirklichung, in der Gefahr der Beliebigkeit. Das Problem sehe ich. Der Glaube ist ja nicht beliebig. Er ist aber weniger formulierte Lehre als tiefes Gottvertrauen. Wenn ich bei meinem Gegenüber ein tiefes Vertrauen spüre – dass Gott uns und die ganze Welt nicht fallen lässt – und trotz allem Elend und Abgründigen eine Lebensfreude wahrnehme, dann steckt in diesem Glauben eine grosse Kraft – etwas, was der Individualismus nie zuwege bringt: Hoffnung. Persönlich bin ich so froh, dass Gott mir diesen Glauben auch gegeben und erhalten hat.
Öffentlichkeit und Medien wünschen zunehmend, dass der Glaube klar zur Sprache gebracht wird.
Wir schreiben Glauben nicht vor, aber wir bekennen den Glauben. Da machen wir Aussagen. Als reformierte Kirche haben wir das geschriebene Bekenntnis infolge des theologischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts zwar nicht mehr. Wir können damit auch die Pfarrschaft nicht auf ein Bekenntnis ordinieren. Es bleibt aber – typisch reformiert – die Verpflichtung auf die Heilige Schrift. Die Pfarrschaft ist frei in der Verkündigung, aber verpflichtet auf die Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes. Wir legen die Verkündigungsfreiheit in die Verantwortung der einzelnen Pfarrpersonen.
Was gibt die Formel „Offene Such- und Weggemeinschaft“ für die Berner Landeskirche noch her?
Ich brauche sie nicht mehr. Das Suchen geschah lange Zeit ohne klare Orientierung. Klar, wir sind unterwegs. Inwieweit die Kirche aber auch als Gemeinschaft zu definieren sei, ist mir gelegentlich fraglich. Auch jene, die sich umarmen, lieben sich nicht immer. Ich halte dafür, dass wir sagen: Wir können nicht offen genug sein – offen für Gottes Wort, offen für die Leitung des Heiligen Geistes, für die Vielfalt der Wege des Glaubens, für die Probleme und Chancen der Gesellschaft. Wir dürfen Gottes Gnade nicht begrenzt denken. Ich plädiere für eine offene Kirche, im Sinn einer inneren Haltung.
Eine Frau, die uns im Rahmen des Täuferjahrs besuchte, sagte mir, ihre Identität liege nicht hinter ihr, sondern vor ihr. Immer wieder suche sie den rechten Weg zu gehen; das verändere ihr Leben. Von daher sage ich: Die Kirche ist im Werden, nicht im Vergehen – auch wenn sie kleiner wird. Auf dem Weg nach Gethsemane sagte Jesus zu seinen Freunden, er werde ihnen nach der Auferstehung nach Galiläa vorangehen. Wenn sie Jesus nachfolgt, ist die Kirche im Werden und ihre Identität immer vor ihr.
Die Synode der Berner Kirche hat 1998 Feiern für Menschen in besonderen Lebenslagen (darunter homosexuelle Paare) zugelassen. Wie weit soll Offenheit gehen?
Grenzen sind Orte der Begegnung und nicht nur der Abgrenzung. Was die Homosexuellen betrifft, haben wir eine schwierige, aber wichtige Erfahrung gemacht: Für beide Seiten war ihre Position zutiefst eine Glaubensfrage. Einer Seite galt die Heilige Schrift als verbindlich, der anderen ging es darum, den Nächsten so zu nehmen, wie er ist. Wir mussten einsehen, dass diese Positionen einander nicht näherzubringen sind. Wir können den andern nicht zwingen, anders zu denken, als seine Überzeugung es bedingt. Nun musste sich zeigen, ob die Frage kirchentrennend ist oder nicht. Die Synode hat es fertiggebracht zu sagen: Wir wollen ob dieser Frage nicht auseinandergehen.
In der Konfirmation kristallisiert sich ein Problem der Volkskirche. Man sagt, dass sie die meisten Jugendlichen hinauskonfirmiert – sie kehren der Kirche nach der Feier den Rücken.
Schon in Calvins Lehrbuch ‚Institutio’ wird über den Sinn der Konfirmation gestritten. Sie geschieht eben dann, wenn Jugendliche partiell mündig werden. Macht es noch Sinn, sie mit dem Schulaustritt zu verbinden? Die Frage ist berechtigt. Grundsätzlich sollte es für alle, die von Geburt an Mitglieder der Landeskirche sind, im Lauf des Lebens Möglichkeiten geben, sich gegenüber der Kirche zu positionieren. Das kann auch eine relativ distanzierte Position sein. Die mittlere Generation hat oftmals einfach zu wenig Zeit, kirchlich akktiv zu sein.
Das Kind hingegen kann sich noch nicht positionieren. Ob die Konfirmation früher oder später angesetzt werden sollte, kann ich nicht beantworten. Wichtig scheint mir, dass sie gehaltvoll durchgeführt wird. Dann erinnert sie auch den Götti, die Gotte und die Eltern an eine Kirche, die etwas zu sagen hat. Da meine Frau viele Patenkinder hatte, habe ich einige Konfirmationen erlebt – ausgezeichnete und bodenlos dünne, ohne Predigt, wo die Kirche als Kirche nicht in Erscheinung trat, sondern bloss das Gebäude zur Verfügung stellte. Die Jugendlichen spüren, ob etwas dran ist oder ob es bloss um den Chlotz (Geld) geht, den sie erhalten.
Wird das Wort ‚Mission’ als Bezeichnung für das, was der Landeskirche aufgegeben ist, wieder salonfähig?
Eine Zeitlang ging ich in eine andere Richtung, sah Dialog als die zeitgemässe Form von Mission. Auch Ökumene heisst Dialog. Nun öffne ich mich wieder mehr und mehr dem, was Mission bedeutet – selbst dem, was man Evangelisation nennt. Nicht in dem Sinn, dass sich Europa bekehren liesse. Aber doch so, dass ich glaube: Wir haben von Jesus Christus die Pflicht und die Aufgabe – aber es muss auch in uns brennen –, das Evangelium weiterzugeben und von Jesus Christus zu erzählen. Auch uns befragen zu lassen. Das muss nicht agressiv geschehen. Alle Christinnen und Christen – Kirche im weitesten Sinn – sind gefragt. Wenn sie das Evangelium nicht weitertragen, wer dann sonst?
Allerdings bin ich ebenso offen für die Stossrichtung von mission21 (früher Basler Mission). Sie versteht sich als internationale Lerngemeinschaft von Kirchen, um voneinander zu lernen, wie wir als Christen in der Welt leben sollen. Mission ist die Globalisierung des Evangeliums – nicht wie in der Vergangenheit kolonial, sondern im gemeinsamen Lernen, im Hören und gemeinsamen Bezeugen.
Was tragen pietistische, erwecklich arbeitende Pfarrer in der Berner Landeskirche zur Erfüllung ihres Auftrags bei?
Ich denke viel darüber nach und halte mich doch mit einem Urteil zurück. Vorweg eine Beobachtung: Ich sehe die Kirche als Institution – und als Bewegung. Das evangelikale Element integriert das Charismatische und fördert persönliche Frömmigkeit. Es organisiert sich über alle Grenzen hinweg – respektive braucht sich gar nicht heftig zu organisieren, denn da wird sofort eine Geistesverwandtschaft erfahren, Gemeinschaft empfunden. Das ist das Bewegende.
Die Kirche hingegen ist als Institution eher das Bewahrende. Das ist nicht negativ zu verstehen. Das Bewahrende und das Bewegende schliessen sich nicht aus, sondern sind aufeinander angewiesen. Man soll also die beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Aber ihr Verhältnis zueinander ist schwierig.
Ich begreife, dass Jugendliche in die Bewegung gehen und ältere Leute eher in der Kirche sind. Evangelikale Pfarrerinnen und Pfarrer sind in einem gewissen Sinn Schlüsselfiguren der Verbindung. Man kann aus einer landeskirchlichen reformierten Gemeinde keine Bewegung machen – das würde ich nicht zulassen. Sonst springen manche Leute ab. Anderseits darf man eine Bewegung nicht verkirchlichen wollen.
Eine Pfarrperson soll für die Institution stehen – und zugleich ein évènement (Ereignis) sein. Der Evangelikale darf nicht vergessen, dass er auch Institution ist. Er soll nicht die Kirche als schwarze Folie brauchen, um sich zu legitimieren. Er soll sich mit der Kirche identifizieren – und sie soll ihn andererseits nicht binden und ihm vorschreiben, wie weit er beispielsweise mit den Jugendlichen charismatisch gehen darf. Die Pfarrpersonen haben insofern eine grosse Verantwortung, als sie theologisch wissen und verantworten müssen, was sie tun. Gleichzeitig haben sie die Chance der freien Verkündigung und beträchtliche Freiheit in der Gestaltung der Gottesdienste. Sie müssen darauf achten, dass die Gemeinden nicht gespalten werden, so dass die Einen sagen: Jetzt kann ich nicht mehr mitmachen.
Wie ernst ist der Vorwurf des Spaltens zu nehmen? Wenn sich Christen in einen Hauskreis zurückziehen oder in eine Freikirche wechseln, weil sie von Gottesdiensten enttäuscht sind, redet niemand von Spaltung. Doch wenn ein Pfarrer den Leuten evangelistisch nahe tritt und etwa Wörter wie Sünde oder Erlösung in den Mund nimmt, ist bald von Spaltung die Rede.
Man muss wohl zurückhaltend mit dem Vorwurf umgehen. Sie sprechen das Gleiche an wie ich vorhin: Es ist nicht so, dass die Gemeinde als solche gespalten wird. Aber die Leute gehen an einen anderen Ort, machen einen inneren oder äusseren Rückzug. Wahrscheinlich gibt es die ideale Gemeinde nicht, in der sich alle wohlfühlen und alle zum Zuge kommen. Der Hirte, die Seelsorgerin der Gemeinde hat darum darauf zu achten, dass er/sie nicht einfach sich selbst zum Massstab nimmt. Es gilt andere zu beteiligen und auch mit ihrem Engagement Gemeinde zu bauen.
Wie wichtig sind pietistische, erwecklich geprägte Gemeinden für die Landeskirche als Ganzes?
Ungefähr so wichtig wie die anderen auch. Einzelne Gemeinden dürfen nicht den Anspruch vertreten, die Kirche in eine bestimmte Richtung zu führen. Denn sie machen mit anderen die Vielfalt dieser Kirche aus. Den Anspruch auf die ganze Kirche weise ich zurück. Nicht einmal der Synodalrat erhebt diesen Anspruch.
Man kann so viele Dinge an der Kirche kritisieren und Vorschläge machen, wie das nun gehen sollte – darüber soll man nachdenken und miteinander reden. Aber es ist nicht einfach so, dass die erwecklich gearteten Gemeinden gleich auch die Erneuerungsbewegung für die ganze Kirche sind. Wiederum: Sie können Neu und Treu nicht gegeneinander ausspielen.
Ich bin überzeugt, dass es viele Arten von Nachfolge gibt, dass sehr viele Menschen in unserer Kirche Jesus nachfolgen, so wie sie den Weg sehen und gehen. Dies kristallisiert sich in den Gemeinden – manchmal lebendiger und manchmal weniger lebendig. Aber man darf die Kirche nicht ständig religiös auf Turbo fahren.
Zur Person:
Samuel Lutz (1944) wuchs in Amsoldingen und Bern auf, studierte in Bern und Montpellier evangelische Theologie und doktorierte 1991 über Zwinglis Gebet. Er wirkte als Pfarrer in Leissigen und war 1988-1993 gleichzeitig nebenamtliches Mitglied des Synodalrates, bevor er 1995 zu dessen Präsidenten gewählt wurde. Samuel Lutz ist verheiratet mit Anne-Marie Lutz-Léchot. In den nächsten Jahren will er sich vermehrt wieder der Theologie, der Musik und der Natur zuwenden.
Bilder Abschiedsgottesdienst: Stahl Photographie
Datum: 29.09.2007
Autor: Peter Schmid
Quelle: Livenet.ch