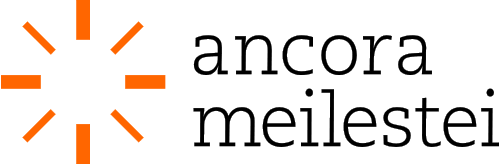Vor fünf Jahren wurde die Solidaritätsstiftung unter Beifall angekündigt. Inzwischen ist der Enthusiasmus verflogen. Trotzdem hat sich das Parlament unlängst für die Stiftung ausgesprochen. Fünfzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: Im Ausland tauchten Presseberichte über die Rolle der Schweizer Banken während der Nazizeit auf. Darauf erfolgten sogenannte «einfache Anfragen» von Schweizer Parlamentariern über die nachrichtenlosen Vermögen von Shoa-Opfern. Die Schweizerische Bankiervereinigung beschwichtigte und verwies auf das Bankengeheimnis – eine Reaktion, die Edgar Bronfman, Präsident des World Jewish Congress (WJC), unverständlich war. Er wandte sich deshalb an den damaligen New Yorker Senator Alfonse D’Amato. Dieser trieb die Situation scheinbar zur Eskalation. Kein Tag ohne Schlagzeilen, Boykottdrohungen und Sammelklagen. Schliesslich überzeugte der internationale Druck den Bundesstaat und die Banken, immense Investitionen in die Aufarbeitung der Vergangenheit und deren «Wiedergutmachung» zu tätigen. Die Ausflüsse davon waren die Aktivitäten der Kommissionen Volcker und Bergier, die Globallösung für die Sammelklagen der Banken, der Holocaust-Spezialfonds – und eben: die Solidaritätsstiftung. Es war am 5. März 1997 als der ehemalige Bundespräsident Arnold Koller eine Solidaritätsstiftung als «zukunftsweisenden Beitrag für eine solidarische Schweiz» ankündigte. Diese gedachte er aus den Erträgen der überschüssigen Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zu speisen. Das sollte so funktionieren: Lange Jahre war es der SNB verboten, Goldverkäufe zu tätigen. Gleichzeitig mussten die Goldvorräte zu Tiefstpreisen bewertet werden. Seit der Währungsreform im März 2000 darf das Gold nun aber zu Marktpreisen bilanziert und verkauft werden. So ist plötzlich für jedermann ersichtlich, dass die SNB mehr Gold hat als es bisher schien. Ungefähr 1300 Tonnen sind überschüssig und werden nicht mehr für die Geld- und Währungspolitik gebraucht, wie Experten schätzen. Inzwischen laufen die Verkäufe des Goldschatzes. Und um die Gelder daraus tanzen Politiker aller Couleur. Auf der einen Seite steht da die SVP. Sie sträubt sich gegen die Solidaritätsstiftung. Weil die Stiftungsidee das Resultat eines Erpressungsmanövers sei. Die SVP möchte vielmehr alle überschüssigen Währungsreserven in den AHV-Fonds fliessen lassen. Tatsächlich liegt dieser Verwendungszweck nahe. Denn zum einen gehört das Nationalbankgold theoretisch dem Volk. Zum andern ruht die Finanzierung der AHV auf wackeligen Beinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zahlten noch neun Erwerbstätige für einen Rentner Beiträge – heute sind es noch dreieinhalb. Nicht von ungefähr kränkelt der AHV-Fonds seit einigen Jahren an Unterdeckung. Der Bundesrat hält indes an der Idee der Solidaritätsstiftung fest. Er lehnt die «Goldinitiative» der SVP ab. Auch weil sie «zu offen» formuliert ist und die Art und die Höhe der Goldreserven nicht nennt. Dies könnte weitere politische «Begehrlichkeiten» wecken, was die Unabhängigkeit der SNB gefährdete. Bundesrat und Parlament haben deswegen einen Gegenvorschlag ausgearbeitet: Die Erträge aus den Goldverkäufen – und nur diese – sollen zu je einem Drittel an die AHV, an die Kantone und die noch zu gründende Solidaritätsstiftung gehen. Das heisst, die Substanz des Sondervermögens aus dem Nationalbankgold bliebe unangetastet. Und die Stiftung für eine solidarische Schweiz würde doch noch Wirklichkeit. Allerdings wäre diese sogenannte «Drittellösung» zeitlich beschränkt, nämlich auf 30 Jahre. «Solidarisch sein ist ja schön und gut», mag man nun einwenden, «nur mit wem sollen wir solidarisch sein?» Mit denen, die in Armut geraten oder Opfer von Gewalt sind – mit benachteiligten Menschen im In- und Ausland. Bereits der Holocaust-Fonds hatte bis zu seiner Einstellung im Jahr 2001 rund 300 Millionen Franken – 200 Million Franken davon waren von der Wirtschaft und 100 von der SNB – an bedürftige Shoa-Opfer in Osteuropa bezahlt. Im Gegensatz zu diesem soll die Solidaritätsstiftung aber «zukunftsgerichtet» und «präventiv» agieren. Darum ist die Zielgruppe der Solidaritätsstiftung die junge Generation. Übrigens wird wegen dieser Zielsetzung auch der Stiftungsrat mehrheitlich aus Personen unter vierzig Jahren zusammengesetzt – inwiefern jüngere Stiftungsräte die Nöte der Jugend und deren Verbesserung tatsächlich kompetenter einschätzen, bleibt allerdings fraglich. Jedenfalls könnten konkrete Projekte zum Beispiel die Linderung der Armut in jungen Familien und Gewaltprävention im Inland sowie Friedensförderung, die Bekämpfung gewisser Krankheiten und die Förderung von Ausbildungen im Ausland sein. Wobei das Ziel immer die Hilfe zur Selbsthilfe bleibt. Die Stiftung wird diesbezüglich Programmschwerpunkte setzten und mit Partnerorganisationen zusammen arbeiten. Auch christliche Werke könnten allenfalls berücksichtigt werden. Die Stiftung beabsichtigt nicht, einen eigenen «Apparat» aufzubauen. Die Oberaufsicht bleibt letztlich beim Bundesrat. Deshalb ist bestmöglichst sicher gestellt, dass die Gelder des Volkes solide Projekte unterstützen. Parlamentarisch ist die Solidaritätsstiftung seit kurzem unter Dach – obwohl die Begeisterung dafür stark nachgelassen hatte und das Projekt mitunter auch schon als «Totgeburt» verspottet wurde. Jetzt liegt es in der Hand der Schweizer und Schweizerinnen, darüber zu entscheiden, ob sie die Solidaritätsstiftung wollen oder nicht. Am 22. September gelangen die «Goldinitiative» und die «Drittellösung» zur Abstimmung. Es können auch beide Alternativen abgelehnt werden. Zuallererst und ganz allgemein: «Geben ist seliger als nehmen.» Dieser Gedanke widerspiegelt sich in der Bibel von den Urvätern bis zur Offenbarung. Zum Beispiel im geradezu legendären Zehnten. Ja, Jesus selbst verspricht in Lukas 6,38: «Schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reiches Mass; Gott wird bei euch dasselbe Mass verwenden.» Wer gibt, erhält dies also letztlich in irgendeiner Form wieder zurück – und mehr als das. Davon zeugt unter anderem das Rote Kreuz. In den letzten fünfzig Jahren wurde der Schweiz ein materieller Wohlstand zuteil wie kaum einem anderen Land. Dies gibt Grund zur Dankbarkeit. Gerade in diesem Sinne sollen wir grosszügig weiter geben und teilen, was wir erhalten haben. Auch als Nation. Die Erträge aus dem überschüssigen Nationalbankgoldschatz fallen der heutigen Generation gewissermassen wie ein Lotto-Sechser zu. Wenn nun im Rahmen der «Drittellösung» ein Drittel davon für Hilfsleistungen an Bedürftige eingesetzt wird, so dürfte das Verhältnis von Einsatz und Ertrag erfreulich ausfallen. Denn oft bewirken geringe Mittel viel. Erfreulicher jedenfalls, als wenn das Gold im politischen Prozess zum Zankapfel verkommt und zu zweifelhaften Mehrausgaben verleitet. Die Probleme, an der die AHV leidet, sind ohnehin struktureller Art. Sie müssen an der Wurzel angegangen werden. Die Goldspritze der SVP bliebe deshalb so oder so eine Symptombekämpfung ohne Langzeitwirkung. Schliesslich darf nicht vergessen gehen, dass die Schweiz in manchen Bereichen Pionierwege beschritten hat. Wieso nicht einmal mehr mit gutem Beispiel vorangehen? Zumal die Solidaritätsstiftung der Welt bereits angekündigt wurde, ist umgekehrt nicht auszuschliessen, dass die Schweiz im Falle einer Beerdigung der Idee in den Augen der Weltöffentlichkeit in Ungnade fiele. Immerhin könnte ein «Nein» zur Stiftung als Wortbruch interpretiert werden. Das wäre schade. Denn auf das Wort eines Landes, das sich einst als Eidgenossenschaft verstand, sollte Verlass sein.Gold in AHV «buttern» – oder «solidarisch» sein?
Die Jugend im Fokus
Solidaritätsstiftung im Lichte des Glaubens
Die Schweiz weist eine humanitäre Tradition auf
Datum: 05.06.2002
Autor: Stephan Lehmann
Quelle: ideaSpektrum Schweiz