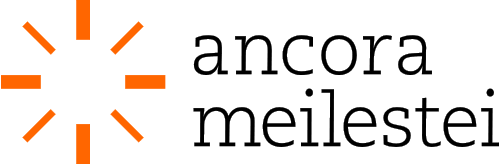An der Konferenz bezeichnete der bekannte Fernsehprediger Yussif Karadawi vom Sender Al-Jazeera diese „Märtyrer-Operationen“ gegen die israelischen Besetzer Palästinas in einem arabischen Wortspiel als „Fortpflanzungs-Bombe“ und einzige Abwehr angesichts der israelischen Atomwaffe. Eine ganze Reihe von Muftis und Rechtsgelehrten schloss sich dieser militanten Sicht an, wie die NZZ schrieb. Und die Ansicht Karadawis, der Widerstandskampf gegen einen fremden Besetzer habe nichts mit Terrorismus zu tun, wurde nicht angefochten. Zu denken geben muss in diesem Zusammenhang der Missbrauch des christlich geprägten Begriffs des Märtyrers in der Berichterstattung der Medien. Ein Märtyrer ist seit den Tagen der Apostel im 1. Jahrhundert, wer den Glauben an Christus, den Herrn und Retter der Menschen bezeugt, unter Druck und Drohungen nicht von diesem Zeugnis ablässt und dafür mit dem Leben bezahlt oder jedenfalls dazu bereit ist. Von bewaffnetem Kampf oder gar selbstmörderischem Anschlag ist da keine Spur. Das griechische Wort ‚martys‘ bedeutet zuerst ‚Zeuge‘, meint also ein friedfertiges Reden und Handeln. Die ersten Zeugen waren die Apostel; sie hatten Christus, den Auferstandenen, mit eigenen Augen gesehen und bezeugten dies ihren Zeitgenossen mit Wort und Tat. Das Zeugnis wurde regelmässig abgelehnt; seine Träger lebten oft gefährlich. Der erste Märtyrer der Kirche, der für das Reden von Christus das Leben hingab, war laut der Apostelgeschichte Stephanus. Der Jerusalemer Gemeindediakon tat Wunder und überwand seine Gegner in Debatten durch seine spirituelle Weisheit. Wenige Jahre nach der Entstehung der christlichen Kirche an Pfingsten wurde er von falschen Zeugen angeklagt und nach einer spitzen Verteidigungsrede gesteinigt. Die Ausbreitung des Evangeliums geschah 300 Jahre lang ohne staatliche Zwangsmittel oder Waffen. Die Christen hatten die Cäsaren gegen sich und rangen gewaltlos um die Herzen der Menschen. Tausende von Christusnachfolgern wurden in römischen Arenen den Bestien vorgeworfen. Mit der Zunahme der Verfolgungen wurde der Kreis der ‚martyres‘ auf jene Christen eingeschränkt, die wegen ihres Bekenntnisses den Tod erlitten hatten. Die anderen, die in Schwierigkeiten Christus treu geblieben waren, nannte man ‚Bekenner‘. Blutzeugen gab es in allen Epochen der Kirchengeschichte. Selbst mächtig geworden, brachte die katholische Kirche viele Menschen, die ein eigenes Verständnis des Glaubens gefunden hatten, als Ketzer auf den Scheiterhaufen. Die Reformatoren suchten die Täuferbewegung auszurotten; 1527 wurde Felix Manz in Zürich in der Limmat ertränkt. Die französischen Bourbonenkönige verfolgten die Hugenotten bis aufs Blut und zwangen Hunderttausende zur Auswanderung. Kein Jahrhundert aber hat Verfolgungen gekannt wie das 20. Jahrhundert, in dem totalitäre Regimes in Europa und Asien gottesfürchtige Christen als Gegner ihrer Ideologie bekämpften. In keinem Jahrhundert haben mehr Christen den Glauben mit ihrem Leben bezahlt, das Bekenntnis zu Christus mit ihrem Blut besiegelt. Wenn Muslime für ein Ziel ihrer geistlichen Führer kämpfen und dabei ihr Leben verlieren, kann zwar ihre seelische Bereitschaft, sich für die Religion aufzuopfern, mit der von entschiedenen Christen verglichen werden. Aber ‚Märtyrer‘ sind sie nicht. Denn Muslime bezeugen nicht den Sieg über den Tod, den Jesus durch das Erleiden des schmachvollen Todes und durch seine Auferstehung erlangte. Der religiöse Rahmen, in dem Muslime den Willen zur Hingabe ihres Lebens entwickeln, ist ein völlig anderer. Dies zeigt sich deutlich in einem Artikels des Politikwissenschafters Babak Khalatbari in der NZZ, der die schiitische Idee des Selbstopfers darstellt. Weil die Gründerväter der schiitischen Heilslehre alle im Kampf (gegen islamische Herrscher!) umkamen, ist für die Schiiten „die Idee des Selbstopfers ein zentraler Gedanke“. Die Schiiten (weltweit etwa 10 Prozent aller Muslime) glauben im Unterschied zu den Sunniten, dass nach dem Tod Mohammeds, des Stifters der Religion, die Führung der Muslime nicht dem ersten Kalifen, Abu Bakr, sondern Ali, dem Schwiegersohn und Cousin Mohammeds, zukam. Doch Ali wurde ermordet, und knapp 20 Jahre später, im Jahr 680, kam auch sein zweitältester Sohn Hussein zusammen mit 72 Getreuen bei Kerbela im heutigen Irak um. Babak Khalatbari schreibt zu diesem Ereignis: „Keiner von den schiitischen Kämpfern, die sich in die aussichtslose Schlacht gegen das vom Kalifen Yazid entsandte Heer stürzten, überlebte das Gemetzel; doch ihre furchtlose Opferbereitschaft ging in die Essenz des schiitischen Glaubens ein. Für die Schiiten ist Hussein der König der Märtyrer (Shah-i Shuhada), dessen Leiden fast an die Passion Christi gemahnt.“ Der Muslim, der ihm nachfolgt, wird ehrenvoll ‚Shahid‘ genannt. Bis zur islamischen Revolution im Iran 1979 warteten die Schiiten auf die Rückkehr einer einst entrückten Führergestalt. Ohne diesen Imam, schreibt Khalatbari, war ein Dschihad, ein islamischer heiliger Krieg, nicht zu führen. Mit Ayatollah Khomeiny änderte dies. Der iranische Revolutionsführer missbrauchte seine überragende Autorität im Krieg gegen den Irak. Er „vermittelte den Soldaten, dass sie auf dem Weg Gottes und in der Gefolgschaft Imam Husseins in den Tod gingen“. Khomeiny verklärte den oft selbstmörderischen Einsatz der schlecht ausgebildeten und ausgerüsteten Kämpfer gegen die Iraker. „Mit religiöser Begeisterung zogen diese Truppen in den Krieg und räumten in der Hoffnung auf einen Märtyrertod sogar Minenfelder oder stürzten sich ins gegnerische Mündungsfeuer.“ Die Kriegsversehrten, die im Iran nach Zehntausenden zählen, tragen den Ehrentitel ‚Dschumbaz‘. Die gefallenen Kämpfer sind nach Khalatbari noch heute im Strassenbild Teherans allgegenwärtig: „Von Betonwänden blicken in Farbe verewigte Kämpfer herab, oft im Augenblick ihres heroischen Ablebens abgebildet... Die grossen Stadtautobahnen sind alle nach einem Shahid benannt.“ Laut dem Artikel gehört ‚Shahid‘ im Koran zu den Beinamen Allahs und bedeutet dort ‚Zeuge‘ oder ‚Augenzeuge‘. In den mündlichen Überlieferungen (Hadithe) bezeichnet das Wort auch den gläubigen Muslim, der im Kampf gegen Ungläubige gestorben ist. Die Hadithe verklären das Leben des Shahid im Jenseits. Die Annahme durch Allah und die Aufnahme ins Paradies – das höchste Ziel gottesfürchtiger Muslime – sei dem Shahid gewiss, heisst es. Er wird dort laut den Überlieferungen bevorzugt behandelt, wie Khalatbari ausführt: „Durch seinen Opfertod entgeht der Shahid so beispielsweise dem Verhör der beiden ‚Todesengel‘ Munkar und Nakir und braucht auch nicht das ‚islamische Fegefeuer‘ (Bazarkh) zu passieren; denn Märtyrer sind von aller Sündenschuld befreit, so dass sie der Fürsprache des Propheten nicht bedürfen und sogar gemäss späteren Traditionen selbst als Fürsprecher auftreten dürfen. Ferner wird ihnen von den Stufen des Paradieses die höchste und bedeutendste zugewiesen, welche in der Nähe von Gottes Thron ist...“ Das Verlangen nach den Freuden des Paradieses führte zu einer „eigentlichen Sehnsucht nach dem Märtyrertod“. Die hohe islamische Geistlichkeit kämpfte allerdings gegen diese Stimmung. Der Selbstmord wird vom Islam verurteilt. Khalatbari beschreibt in seinem Artikel, wie die Herrscher im Iran und im Irak während des Kriegs in den 1980-er Jahren die Opferbereitschaft im Fussvolk schürten. „Die Hinterbliebenen der irakischen Gefallenen erhielten ein Auto sowie 10‘000 Dinar (damals etwa 33‘000 US-Dollar), auf der iranischen Seite wurden den Nachkommen der getöteten Soldaten gewaltige Vorteile im Bildungssystem gewährt.“ Wie man weiss, bezahlt der irakische Diktator Saddam Hussein derzeit den Familien von Selbstmordattentätern in den Palästinensergebieten 25‘000 Dollar. „Die Angehörigen von Freischärlern, die im Nahkampf mit der Armee ihr Leben lassen, werden dagegen lediglich mit 2000 Dollar bedacht - die gleiche Summe, die von dem irakischen Despoten als Entschädigung für jede von den Israeli zerstörte Wohnung ausgezahlt wird.“ Die Ausbeutung der Opferbereitschaft durch Khomeiny war die Saat für eine blutige Ernte, die nun an mehreren Fronten aufzugehen scheint. 1983 verübten die schiitischen Hisbollah-Milizen im Libanon die ersten Selbstmordattentate gegen amerikanische, französische und israelische Soldaten. Von da fand die Kampfform Eingang in den israelisch-palästinensischen Konflikt. Anderseits wurde die Forderung des Selbstmordanschlags auch Teil der Schulung radikal-islamistischer Freischärler in Afghanistan. Babak Khalatbari erwähnt Schriften von Abdullah Azzam, der Osama bin Laden beeinflusst hat. Darin „werden die im Kampf gefallenen Kämpfer auf eine Art und Weise verherrlicht, dass man glauben könnte, es sei der eigentliche Lebenszweck, sich von den Ungläubigen zerfetzen zu lassen“. Der Islam zielt auf die Unterwerfung aller Menschen unter Allah ab; diese Hingabe, glauben Muslime, wird der Welt Frieden bringen. Dass im Kampf zur Rückgewinnung ‚islamischen‘ Territoriums, im Kampf gegen den Judenstaat Israel, der Selbstmordanschlag bejaht wird, auch von hohen Würdenträgern und Gelehrten, wirft einen dunklen Schatten auf den Islam. Die von Hamas-Strategen zum Selbstmord-Anschlag gedrängten jungen Palästinenser als Märtyrer zu bezeichnen, ist verfehlt. Im scharfen Kontrast zur Sonderbehandlung im Paradies, die den Kämpfern Allahs verheissen wird, stehen Worte von Jesus Christus an seine Freunde, die zum entschiedenen, gewaltfreien Bekenntnis rufen – und hohe Verheissungen in sich tragen. Christus ist nach altem christlichem Bekenntnis der Retter, vom Himmel gekommen, Sieger über die Mächte der Finsternis und des Todes; er sitzt auf dem Thron, zur Rechten Gottes, und legt für die Fürsprache ein, die ihr Leben ihm hingegeben haben: „Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s finden.“Missbrauch eines christlich geprägten Begriffs
Treue zu Christus – bis in den Tod
Höhepunkt der Christenverfolgung im 20. Jahrhundert
Schiitische Aufopferungsbereitschaft...
...vom Ayatollah im Krieg missbraucht
Tod im Minenfeld
Unwiderstehlich: Phantasien von Paradiesfreuden
Saddams Dollars für Hinterbliebene in Gaza
Iran, Libanon, Afghanistan, New York
Wille zum Frieden?
Christus, der Fürsprecher im Himmel
Datum: 14.03.2003
Autor: Peter Schmid
Quelle: Livenet.ch